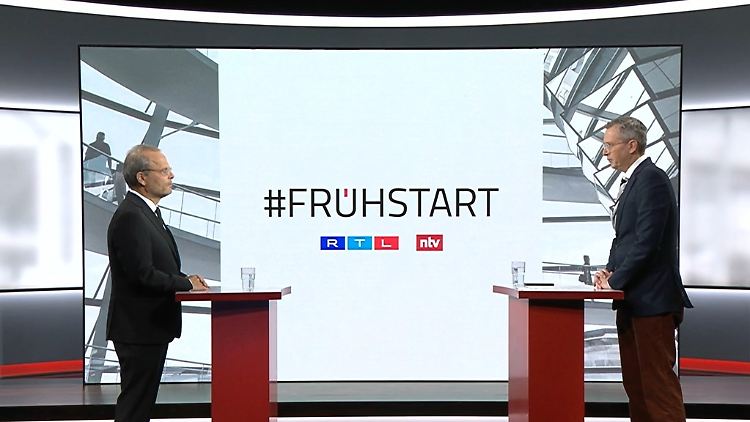Goldene Bush-Jahre für Superreiche Soziale Kluft vertieft
11.08.2008, 10:16 UhrFür ein rundum erquickliches Leben in Wohlstand braucht ein US-Ehepaar mit zwei Kindern im Jahr rund 648.000 Dollar (354.000 Euro). Darin sind Schulgebühren (49.000 Dollar) enthalten wie auch die Mitgliedschaft im Country-Club (25.800 Dollar), die Haushälterin (47.000 Dollar), der Klavierlehrer (3177 Dollar), die Kosten für den Labrador-Hund (5350 Dollar), der Urlaub in Massachusetts (19.450 Dollar) oder die Saison-Karten für das Redskin-Footballteam (5300 Dollar). Das Magazin "Washingtonian" hat diese Standard-Liste für die wohlhabenden US-Bürger erstellt - jene rund drei Millionen unter den rund 300 Millionen Einwohnern der USA, denen es in den Amtsjahren von Präsident George W. Bush ganz besonders gut ging.
Noch sehr viel bessere Jahre aber hatten die rund 340.000 Superreichen, deren Vermögen zehn Millionen Dollar übertraf. Und eine wahrhaft goldene Ära erlebten die rund 420 amerikanischen Milliardäre, die nicht nur von Marxisten als die heimlichen Herrscher Amerikas betrachtet werden - Männer wie Bill Gates, Warren Buffett oder Donald Trump. Sie kennt in den USA jeder kleine Junge, eher unbekannt sind Kapitalistenfamilien wie die der Hunts oder Waltons.
Überholtes Kapitalismusbild
Im Land der meisten Milliardäre und Millionäre in der Welt konnten die Besitzenden ihren Reichtum mehren wie schon lange nicht mehr. Drastische Steuerkürzungen Bushs begünstigten vor allem Unternehmer, Aktienbesitzer und Spitzenverdiener. "Früher gab es den Gegensatz zwischen Arm und Reich, heute geht es mehr um den zwischen den Ultra- Reichen und allen anderen", schrieb die "New York Times".
Das von John F. Kennedy gepriesene Kapitalismusbild, demzufolge Wirtschaftswachstum wie die Flut ist, die nicht nur Jachten und Tanker (sprich: die Reichen), sondern alle Boote, auch die kleinen Kähne und Schiffchen (sprich: die Ärmeren) steigen lässt, scheint nicht mehr zu stimmen. Zwar ermöglichte der Wirtschaftsboom, dass die Arbeitslosenquote meistens unter fünf Prozent blieb - für europäische Staaten eine wahre Traumquote. Aber am meisten profitierten vom Wachstum jene, die ohnehin schon Vermögen hatten.
Besitzende und Habenichtse
Gallup-Umfragen zeigen, dass eine wachsende Zahl der Amerikaner ihr Land in Besitzende und Habenichtse gespalten sieht - dabei sind in der amerikanischen Gesellschaft Neidgefühle weit weniger verbreitet als anderswo, traditionell werden hier Erfolg und Vermögen bewundert und respektiert. In der Hochburg des Kapitalismus gibt es tatsächlich besonders viele Unternehmer wie Microsoft-Begründer Gates, den Computer-Produzenten Michael Dell oder die Google-Gründer Sergey Brin und Larry Page, die ihren nunmehr sagenhaften Reichtum mit Kreativität und Tatkraft quasi aus dem Nichts schufen.
Aber schon 2005 warnte der damalige Chef der US-Zentralbank, Allen Greenspan, vor den "Gefahren für die Stabilität des demokratischen Kapitalismus", wenn sich die sozialen Unterschiede weiter verschärften - auch wenn die letzten 20 Jahre die "wirtschaftlich erfolgreichstes Periode der US-Geschichte" gewesen seien, wie der legendäre Hüter des kapitalistischen Systems betonte.
Der amerikanische Traum wird seltener wahr
Noch nie seit den 30er Jahren habe es eine solche Konzentration von Vermögen gegeben wie heute, heißt es in einer Studie des Wirtschaftswissenschaftlers Isaac Shapiro vom Politikinstitut "Center on Budget and Policy Priorities". Ein Prozent der Bevölkerung bezieht demnach 19,5 Prozent aller Einkommen, die obersten zehn Prozent kommen auf 46 Prozent. Laut des neokonservativen Politikinstituts AEI in Washington hatten die best verdienenden 30.000 Amerikaner 1980 einen Einkommensanteil von etwa 0,9 Prozent - 2006 hatte sich der auf 3,9 Prozent mehr als vervierfacht.
"Der Durchschnittsamerikaner hatte kaum etwas von der ökonomischen Expansion", schrieb Prof. Scott Lilly vom linksgerichteten "Zentrum für amerikanischen Fortschritt". Über 95 Prozent des Wachstums zwischen 2000 und 2006 sind demnach gerade einmal zehn Prozent der US-Haushalte an der Spitze der Einkommenspyramide zugute gekommen.
Im Land der unbegrenzten Möglichkeiten lässt sich der amerikanische Traum offenbar immer schwerer verwirklichen. Die Durchlässigkeit des Systems - die Möglichkeit für Kinder aus ärmeren Schichten, sich empor zu arbeiten - hat sich verschiedenen Studien zufolge in den vergangenen Jahren deutlich verschlechtert. Der Ex-Präsident der Harvard-Universität, Lawrence Summers, nannte es "erschütternd", dass nur zehn Prozent der Studenten an den Elite-Universitäten aus Familien stammen, die sich in der unteren Hälfte der Einkommensstatistik befinden.
Quelle: ntv.de, Laszlo Trankovits, dpa