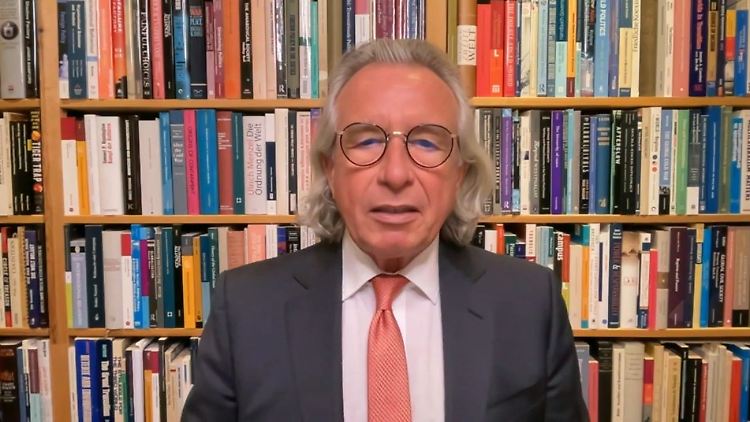Die Berliner Erklärung "Das macht Merkel selbst"
20.03.2007, 09:13 UhrAm kommenden Wochenende, zum 50. Jahrestag der "Römischen Verträge", wird die Europäische Union in Berlin eine "Berliner Erklärung" verabschieden. Die Regierungen der EU haben Bundeskanzlerin Angela Merkel freie Hand bei der Formulierung der Erklärung gegeben. Über Inhalt oder gar Wortlaut ist bisher kaum etwas bekannt. Die Erwartungen sind hoch wie selten - die Berliner Erklärung werde eine "Initialzündung" für den Neustart der Debatte über die europäische Verfassung sein, sagt der CDU-Europapolitiker Michael Stübgen. Er ist sicher: Den letzten sprachlichen Schliff wird Merkel der Erklärung selbst geben.
n-tv.de: "Das Verhältnis von Integration zu Erweiterung ist unterschiedlich", hat die Bundeskanzlerin beim jüngsten EU-Gipfel in Brüssel beklagt. Was muss passieren, damit hier wieder eine gewisse Balance einkehrt?
Michael Stübgen: Nach meiner Einschätzung ist es sehr wichtig, dass wir den Verfassungsvertrag bekommen - am besten so, wie wir ihn verabschiedet haben, oder sehr nahe am jetzigen Text. Denn es ist in der Tat so, dass die Unübersichtlichkeit der europäischen Entscheidungen mit der Zahl der Mitglieder zunimmt. Das bestehende System wurde ursprünglich für sechs, zwölf, fünfzehn Mitglieder geschaffen. Für 27 reicht es nicht aus.
Im Juni findet der Verfassungsgipfel statt, mit dem die selbstauferlegte "Denkpause" der EU endet. Angela Merkel will dann einen Fahrplan vorlegen, um die auf Eis liegende Verfassung zu retten. Wie könnte dieser Fahrplan aussehen?
Der Europäische Rat hat ein Zieldatum festgelegt: Der Verfassungsvertrag, oder wie immer er dann heißen mag, soll spätestens Anfang 2009 in Kraft treten. 2009 wird das Europäische Parlament gewählt und eine neue Europäische Kommission eingesetzt. Mehr ist noch nicht klar. Wir haben aber glücklicherweise noch ein bisschen Zeit bis zum Juni.
Polen will die Abstimmungsregeln neu verhandeln. Wie könnte eine Lösung bei diesem Thema aussehen?
Die Einführung der doppelten Mehrheit war ein Kernelement der Verfassung, um das wir lange gerungen haben. Die doppelte Mehrheit bringt eine gerechtere Berücksichtigung der Einwohnerzahl und achtet gleichzeitig darauf, dass auch kleinere Länder ausreichend Einfluss haben. Polen bevorzugt natürlich das geltende System des Nizza-Vertrags, weil es da überproportional gut wegkommt. Ich glaube, das Problem ist nur mit Gesprächen zu lösen. Tatsache ist: Mit dem Verfassungsvertrag würde Polen nicht deutlich weniger Stimmen bekommen. Die Zahl der Stimmen bliebe ungefähr gleich, weil Polen ja auch ein großes Mitgliedsland ist.
Aber sie könnten dann überstimmt werden.
Das können sie jetzt auch schon. Das Problem ist wohl eher, dass Polen den relativ starken Stimmenzuwachs für Deutschland nicht ganz einsieht. Aber ich glaube, da ist kooperativ eine Lösung möglich.
Mit anderen Worten: Inhaltliche Zugeständnisse soll es nicht geben.
Richtig. Das ist in erster Linie Psychologie. Den Ansatz der Bundesregierung hat Angela Merkel am vergangenen Wochenende sehr erfolgreich demonstriert. Für gewisse Kräfte in der polnischen Regierung ist die Nachkriegszeit noch immer nicht zu Ende. Das müssen wir überwinden. Deutschland ist keine Gefahr für Polen, im Gegenteil, Polen ist für uns ein ganz wichtiger Partner, wie wir für Polen auch. Nur gemeinsam können wir vernünftige Wege finden. Ich sehe da gute Chancen. Bei der Zuordnung der doppelten Mehrheit gibt es zum Schluss möglicherweise noch einen kleinen Spielraum.
Ihr Parteifreund Peter Altmaier fordert eine europaweite Volksabstimmung über die neue EU-Verfassung.
Grundsätzlich finde ich das eine sehr gute Idee. Praktisch ist sie allerdings nicht umsetzbar. Ein EU-weites Referendum setzt ein EU-Staatsvolk voraus, das es nicht gibt und auf absehbare Zeit wohl auch nicht geben wird.
Angela Merkel hat gesagt: "Die Schlacht um die Verfassung wollen wir nicht in der Berliner Erklärung schlagen." Welche Rolle spielt die Berliner Erklärung für die Verfassung?
Die Berliner Erklärung wird eine Initialzündung sein. In der Berliner Erklärung werden alle Staats- und Regierungschefs in einem kurzen Text - schon das ist etwas Besonderes - gemeinsam feststellen, wo die Erfolge der europäischen Politik liegen, wo wir Defizite haben und was wir tun wollen, um diese Defizite zu beheben. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Auf der Basis dieser Erklärung werden die Sherpas weiter an der Road Map arbeiten, die dann auf dem Juni-Gipfel verabschiedet werden soll.
Der Begriff "Verfassung" taucht aber nicht auf.
Das hätte in einigen Mitgliedsländern Implikationen, die nur unnötige Komplikationen auslösen würden. Ob das Wort drin steht oder nicht - wesentlich sind die Inhalte, die politische Substanz, an der wir festhalten.
Bislang ist über den Inhalt der Erklärung nur wenig bekannt. Der Grünen-Fraktionschef im Europaparlament, Daniel Cohn-Bendit, hat der Bundesregierung "Geheimniskrämerei" vorgeworfen.
Im Gegensatz zu den bisherigen europäischen Texten sollte die Berliner Erklärung eben nicht durch 27 Regierungen laufen, möglicherweise auch noch durch 27 Parlamente, die parlamentarischen Vertretungen oder die COSAC, die Konferenz der Europa-Ausschüsse in der Europäischen Union. Wenn solche Texte dort verabschiedet werden, brauchen wir im günstigsten Fall Monate, mitunter Jahre. Zudem wird es dann wieder ein unleserliches Kompendium. Als Parlamentarier sage ich natürlich auch, dass ich gern direkt am Text mitberaten und mitentscheiden würde. Aber die Formulierung eines Textes, der auch für den europäischen Bürger verständlich ist und nicht nur für Experten, kann nur im engsten Kreis gelingen. Wir haben in Deutschland ein hervorragendes Dokument, das sich enorm bewährt hat: das Grundgesetz. Das ist auch von einer sehr kleinen Runde ausgearbeitet worden. Diese Chance sollten wir den Regierungschefs geben. Kritisieren können wir später immer noch.
Ist diese Geheimpolitik nicht typisch für die EU - in großen Runden klappt kaum etwas, selbst die Demokratisierung muss hinter verschlossenen Türen vorbereitet werden?
Typisch für Europa ist, dass wir nach Wegen suchen, um aus der Selbstblockade herauszukommen. Nach dem Maastrichter Vertrag, der ein wirklicher Durchbruch war, haben wir erlebt, dass die Regierungskonferenzen immer wieder nicht die entscheidenden Themen erledigen konnten. Mit dem Konvent hatten wir dann ein neues Modell. Der Verfassungskonvent war zusammengesetzt aus Vertretern der nationalen Parlamente, des Europaparlaments, der EU-Kommission und der Regierungen. So entstand der Verfassungsvertrag, der zwar von 18 Ländern ratifiziert wurde, aber in zwei Referenden gescheitert ist. Jetzt müssen wir neue Wege gehen. Die Berliner Erklärung ist so ein neuer Weg: ein leserlicher Text, der in knappen Worten feststellt, was wir tun wollen. Ich halte das für einen sinnvollen Versuch. Ob er uns gelingt, werden wir sehen.
Einen Gottesbezug soll es in der Berliner Erklärung nicht geben. Fällt Ihnen der Verzicht schwer?
Ich bin ja von Beruf protestantischer Pfarrer. Trotzdem fällt mir persönlich der Verzicht nicht so schwer. In den Mitgliedsländern gibt es nun einmal unterschiedliche historische Grundsätze. Frankreich zum Beispiel ist durchaus kein atheistisches Land. Sie sehen sich aber nicht in der Lage, einen Gottesbezug in die Verfassung aufzunehmen, weil in ihrer Staatstradition Kirche und Politik strikt getrennt sind. Der Verfassungsentwurf verweist auf den kulturellen und religiösen Hintergrund Europas. Ich glaube, das reicht aus. Am Gottesbezug sollten wir dieses Projekt nicht scheitern lassen.
Wer schreibt eigentlich die Endfassung der Berliner Erklärung? Angeblich kommt der letzte sprachliche Schliff von einem "externen Autor".
Hans-Magnus Enzensberger ist es wohl nicht, habe ich gelesen. Für die Zuarbeit sind, soweit ich weiß, hervorragende Leute angesprochen worden. Aber die letzte Hand wird Angela Merkel anlegen. Da bin ich ganz sicher.
(Die Fragen stellte Hubertus Volmer.)
Quelle: ntv.de