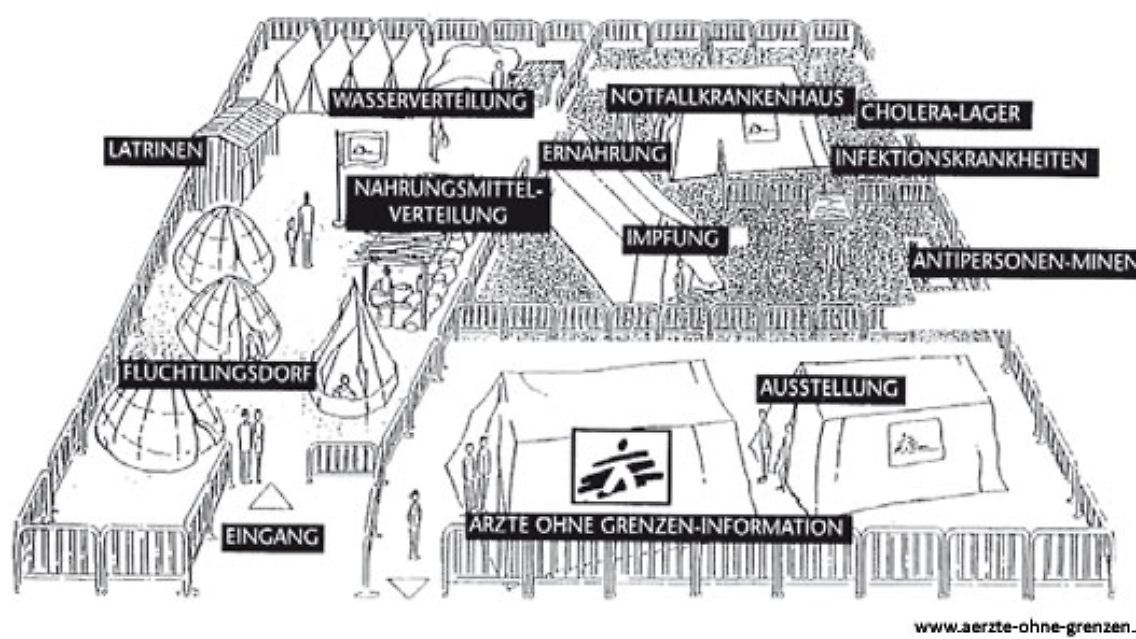"Das Tor nach Europa" Lampedusa kämpft mit Migration
26.05.2009, 14:16 UhrDie erschütternden Bilder gehen immer wieder um die Welt. Sie zeigen verzweifelte Menschen, die unter gefährlichsten Bedingungen in primitiven Booten ihre afrikanische Heimat verlassen haben und erschöpft das rettende Land erreichen. Das Problem der Bootsflüchtlinge wird einer der Schwerpunkte des G8-Treffens der Innen- und Justizminister am 29. und 30 Mai in Rom sein. Die Küstenländer Europas wie Italien fühlen sich alleingelassen und verlangen Hilfe von der EU. Die Auffanglager in Italien, Malta und Griechenland sind hoffnungslos überfüllt. Zu trauriger Berühmtheit gelangte besonders die kleine Insel Lampedusa im tiefen Süden Italiens.
Aus der Luft sieht Lampedusa südlich von Sizilien aus wie der karge Rücken einer steinernen Schildkröte. Erst aus der Nähe eröffnet sich dem Besucher die herbe Schönheit der südlichsten Insel Italiens. Kristallklares Wasser umspült malerische Felsen und saubere, weiße Sandstrände. Wohin das Auge reicht, wachsen inmitten von stacheligem Gestrüpp und Gestein wilde Blumen und Kräuter: Gelbe Margeriten und rosa Malven halten sich tapfer auf den Felsen neben wild wachsenden Artischocken und Fenchel. Höhere Bäume gibt es kaum - von vereinzelten Olivenbäumen und Palmen abgesehen. Feigenkakteen und Agaven bestimmen das Bild. Ab und zu trifft man auf einen privaten Gemüsegarten und ein paar herumstreunende Ziegen, der karge Boden scheint jedoch für Ackerbau und Viehzucht eher ungeeignet. Alles wirkt wild und einsam.
Auch der einzige Ort der Insel, der ebenfalls Lampedusa heißt, scheint friedlich und verschlafen in der Sonne zu liegen. Ein Hund wacht auf einer Mauer träge über das Geschehen. Kleine Jungs spielen Fußball auf dem für diesen Sport ungeeignet holprigen Kopfsteinpflasterplatz vor dem fest geschlossenen Bürgermeisteramt. Und selbst in der Via Roma, der Hauptstraße, in der vom einzigen Pub bis zum Gemüse- und Schreibwarenhändler alles zu finden ist, plätschert das Leben still vor sich hin. Ein paar alte Männer stehen schwatzend um einen kleinen Gemüsewagen herum. Frauen eilen mit plärrenden Kindern an der Hand unbekannten Zielen zu. Die afrikanisch anmutenden, würfelförmigen Bauten in hellen Farben verleihen dem Ort etwas Kindliches. Ein friedliches Sommeridyll? Der Schein trügt.
Migrationsstrom seit 2003

Im Januar 2009 sind Immigranten aus einem Flüchtlingslager ausgebrochen.
(Foto: picture-alliance/ dpa)
Die geballte Präsenz von Militär und Polizei auf der Insel macht auch uninformierten Beobachtern schnell klar, was Lampedusa heute bedeutet. Denn nicht nur der Vegetation der Insel sieht man ihre Nähe zu Nordafrika an. Die mit nur 20 Quadratkilometern größte der Pelagischen Inseln ist dank ihrer Nähe zum Schwarzen Kontinent für viele zur Insel der Hoffnung geworden. Für die Tausenden von Verzweifelten, die jedes Jahr ihr Leben aufs Spiel setzen und in hoffnungslos überfüllten, meist seeuntüchtigen Fischerbooten die gefährliche Überfahrt von Afrika in Richtung Europa wagen, ist Lampedusa, das nur knappe 120 Kilometer von der tunesischen Küste entfernt liegt, das "Tor nach Europa". Das war nicht immer so.
"Erst vor etwa sechs Jahren sind die ersten Bootsflüchtlinge hier angekommen", erzählt Pina, deren Familie seit Generationen auf Lampedusa lebt. Am Anfang seien es nur wenige gewesen. "Damals haben wir Lampedusaner diesen armen Menschen geholfen." Dann wurden es zu viele. Rund 36.500 Bootsflüchtlinge strandeten 2008 an den italienischen Küsten, rund 32.000 von ihnen auf Lampedusa. In den ersten vier Monaten 2009 sollen es nach Angaben des Innenministeriums bereits weit über 4000 gewesen sein. Angesichts der Migrationsströme änderte das Innenministerium Anfang des Jahres seine Politik der ersten Hilfe und wandelte das für rund 800 Insassen taugliche Hauptauffanglager der Insel "Contrada di Imbriacola" in ein "Lager zur Identifikation und Abschiebung" (CIE) um. Die Immigranten, die vorher innerhalb möglichst weniger Tage in dem Lager versorgt worden waren, um dann in besser ausgestattete Strukturen auf dem Festland überwiesen zu werden, müssen nun auf der Insel bleiben, um auf ihre Abschiebung nach Afrika zu warten.
Militärische Präsenz prägt die Insel
Seit einem friedlichen aber spektakulären Ausbruch von etwa 1300 Flüchtlingen aus dem hoffnungslos überfüllten Auffangzentrum im Januar befinden sich - aus Sicherheitsgründen - durchschnittlich zwischen 850 und 1500 Beamte von Polizei und Militär auf der Insel. Während man von den Flüchtlingen kaum etwas bemerkt, gleicht die Insel einem besetzten Felsen. Die "Forze dell'ordine" (die Ordnungskräfte) sind allgegenwärtig. Sie rauschen mit ihren Jeeps über die wenigen Straßen der Insel, sitzen in jedem Café, in jeder Pizzeria, an jedem Strand. Viele Lampedusaner verdienen an ihnen gutes Geld. Die meisten sind jedoch unzufrieden.
"Wir wollen keine Gefängnisinsel à la Alcatraz werden", protestiert so manch einer gegen die Abschiebelager, die zunehmend als Existenz bedrohend empfunden werden. Denn wovon soll man leben, sollten die Touristen endgültig wegbleiben? "Hier wird nicht mehr gearbeitet", klagt Emanuele Billardello, der sich bis vor kurzem sein Geld mit Bootstouren und Appartement-Vermietung an Touristen verdiente. "An Ostern hatten wir normalerweise 300 bis 500 Gäste - je nach Wetterlage. Jetzt waren es noch knappe 30. Es kommt einfach keiner mehr wegen der vielen Militärs und der Flüchtlingsgeschichten." Und auch Pina hat es nicht einfach. "Mein Mann ist Fischer. Mit Schwertfisch hat er noch gut verdient, aber das ist jetzt verboten", erzählt die Lampedusanerin. Aus der Misere des Fischfangs hatte sie sich in den Tourismus gerettet. Sie vermietet in der sommerlichen Hochsaison auch ihre eigene Wohnung und zieht in einen Wohnwagen. Doch "ohne Touristen weiß ich auch nicht mehr weiter".
Nicht alle lehnen die Flüchtlinge ab
Die meisten der Inselbewohner pflegen trotz allem in ihrem Herzen die Gastfreundschaft und Hilfsbereitschaft, für die Italien einst so bekannt war - und dies nicht nur Touristen gegenüber. "Die wollen doch nur ein besseres Leben", meint der alte Fischer Giovanni verständnisvoll über die Immigranten und erinnert sich, dass auch einer seiner Brüder nach Kanada ausgewandert ist. "Wir machen es doch genau so: Wir sind früher ausgewandert und wir wandern heute aus. So ist das Leben eben." Der 85-Jährige erzählt gerne - und häufig - jedem, der es hören möchte, dass er die Einwanderer früher eigenhändig gerettet und versorgt hat. "Da gab es auf der Insel noch keine Polizei und auch keine Flüchtlingslager", sagt er mit viel Mitgefühl. Heute ist das zum Teil schwierig. Denn oft wird mutigen Fischern, die Flüchtlinge aus dem Wasser ziehen, nachher erstmal das Boot konfisziert - unter dem Verdacht der Hilfe zur illegalen Einreise. Und das ist ruf- und geschäftsschädigend.
Der italienische Innenminister Roberto Maroni der ausländerfeindlichen Lega Nord rechtfertigt das Abschiebelager auf der Insel damit, dass die Flüchtlinge von dort nicht weg können. Wenn die Immigranten erstmal das Festland erreichten, so Maroni, würden viele einfach in die Illegalität abtauchen. Sein umstrittenes Gesetz zur Flüchtlingspolitik, das unter anderem einen verlängerten Aufenthalt in CIE-Lagern wie dem von Lampedusa vorsieht, ist vor kurzem besiegelt worden.
Unerträgliche Lebensbedingungen für die Flüchtlinge
"Jede Art einer dauerhaften Unterbringung auf Lampedusa ist extrem schwierig", protestiert dagegen Barbara Molinario, Vertreterin des UN-Flüchtlingshochkommissariats (UNHCR) auf Lampedusa. Die Lagerkapazität, die Kapazität der Insel, die für Inselbewohner und Flüchtlinge etwa nur über eine einzige ambulante Krankenstation verfügt, seien völlig unzureichend für ein derartiges Vorhaben. "Als Anfang des Jahres vorübergehend alle Flüchtlinge auf Lampedusa festgehalten wurden, waren die Lebensbedingungen für die Migranten absolut unerträglich", so Molinario. Damals waren rund 1800 Menschen im zentralen Auffanglager der Insel eingepfercht - mehr als das Doppelte der Lagerkapazität.
Um Platz zu schaffen, unternahm die Regierung gegen den erbitterten Widerstand der Inselbevölkerung den Versuch, ein weiteres Abschiebelager in der ehemaligen Militärbasis "Loran" zu bauen. Der Zutritt zu dem Lager ist Außenstehenden streng verwehrt. Jedoch selbst nach Angaben der sonst kritischen Hilfsorganisationen ist die "Base Loran" an der Westspitze Insel ein wesentlich angenehmerer Ort als das alte Auffangzentrum, das heute als Abschiebelager dient. Die Militärbasis dient nun aktuell als Flüchtlingslager für "empfindliche Kategorien", das heißt Frauen, Minderjährige und Familien mit Anrecht auf Asyl, während im "Contrada di Imbriacola" Männer untergebracht sind, die abgeschoben werden sollen.
Flüchtlingslager oder direkte Abschiebung?
"Hier ist es wie in Guantanamo", sagt Mario, einer der tunesischen Flüchtlinge, die seit Monaten darauf warten, das Lager verlassen zu können, polemisch und sichtlich am Rande seiner Nerven. Andere stürzen herbei, um wenigstens ein Stückchen ihrer Geschichte zu erzählen. Amin aus Marokko wollte zu seiner Schwester nach Berlin, der blutjunge Mohammed, der erzählt, er habe seinen 20. Geburtstag auf dem Meer gefeiert, zu Verwandten in Frankreich. Die wenigsten wollen in Italien bleiben. Und die meisten warten auf ihren Ausreisebefehl, als wäre dieser ein Visum. Denn das sogenannte "Foglio di Via", nach dem sie innerhalb von fünf Tagen das Land verlassen müssen, bedeutet für viele Flüchtlinge noch "eine Chance" - sich durchzuschlagen, Nordeuropa zu erreichen, vielleicht doch nicht zurückgeschickt zu werden.
In den vergangenen Wochen geriet Italien erneut international ins Kreuzfeuer der Kritik mit direkten Abschiebungen von Bootsflüchtlingen nach Libyen, die auf See aufgegriffen worden waren. Laurens Jolles, Vertreter des Flüchtlingshochkommissariats der UN (UNHCR), warf der italienischen Regierung des konservativen Ministerpräsidenten Silvio Berlusconi vor, mit der direkten Abschiebung gegen die Genfer Flüchtlingskonvention zu verstoßen. Sie gelte auch in internationalen Gewässern und sei auch in der italienischen Gesetzgebung enthalten. Von den rund 36 500 Flüchtlingen, die 2008 an italienischen Küsten strandeten, stellten rund 75 Prozent von ihnen einen Antrag auf Asyl. In mindestens 50 Prozent der Fälle wurde dem Antrag stattgegeben.
Maroni hält dagegen, dass das Problem ein europäisches sei, und es daher einer umgehenden Lösung von europäischer Seite bedürfe. "Die Rückführungen von Immigranten werden nicht unterbrochen", ist die Antwort des Innenministers im Einklang mit Ministerpräsident Silvio Berlusconi. Sein Vorschlag, die Begutachtung der Asylanträge bereits in Afrika zu bewältigen, nicht zuletzt auch, um die allzu oft tragisch endenden Überfahrten übers Mittelmeer zu verhindern und den kriminellen Schleppern das Handwerk zu legen, wurde von den Hilfsorganisationen bisher kritisch abgelehnt. Als besonders problematisch beurteilen die UN dabei die Tatsache, dass Libyen die Genfer Konvention nicht unterzeichnet hat und über kein wirkliches Asylrecht verfüge.
Die libysche Hölle
Dagwami Yimer verließ im Winter 2005 im Alter von 27 Jahren seine Heimat Äthiopien. "Es ist nicht, dass ich Hunger leiden musste in Äthiopien. Aber ich hatte keine Hoffnung mehr. Meine Flucht war mein politischer Protest gegen die äthiopische Regierung, bei der man von Demokratie nicht sprechen kann", erklärt Dagmawi heute seine Beweggründe. "Es war klar, dass es für mich unmöglich gewesen wäre, gegen die Macht der Regierung etwas zu verändern, mein Leben zu verbessern, ohne es aufs Spiel zu setzen. Da habe ich mir gesagt, wenn ich schon mein Leben riskiere, dann um wirklich etwas zu verbessern."
Dagmawi, genannt Dag, schlug sich über den Sudan nach Libyen durch. Erst fiel er Menschenhändlern in die Hände, dann wurde er von der libyschen Polizei verhaftet. Ein Sturz vom Regen in die Traufe: Die Polizei deportierte die Gruppe von Flüchtlingen und setzte sie ohne Wasser in der Wüste aus. Dagmawi Yimer kämpfte sich zurück an die libysche Küste und wagte die lebensgefährliche Schiffsreise über das Mittelmeer. Seine und die Erfahrung von anderen jungen Migranten hat er mit zwei italienischen Regisseuren und Freunden in dem Film "Wie ein Mensch auf Erden" zusammengefasst. Die Behandlung in Libyen gehört zu seinen schlimmsten Erinnerungen.
"Einer schafft es, drei nicht"
Ähnlich wie die Hilfsorganisationen heute gegen die direkten Abschiebungen protestieren, klagt der junge Äthiopier einen Teil Europas an. Mit Finanzspritzen und Wirtschaftsabkommen sollte dafür gesorgt werden, Libyen oder auch andere afrikanische Küstenländer, in denen die Beachtung der Menschenrechte bis heute nicht garantiert ist, zur Endstation der Flucht zu machen.
Flüchtlingstragödien auf dem Mittelmeer, bei denen zuletzt Anfang des Jahres vermutlich mehr als 600 Menschen ums Leben kamen, mehren sich jährlich. "Auf jeden, der es schafft, kommen mindestens drei, die es nicht schaffen", meint Dag. Der traurige "Cimitero delle barche" (Schiffs-Friedhof) im Zentrum der Insel, der die zerstörten Fischer- und Schlauchboote der Immigranten beherbergt, erinnert daran wie auch das Denkmal "Porta d'Europa" an der Hafeneinfahrt von Lampedusa. Der italienische Künstler Mimmo Paladino schuf es zum Gedenken an die Toten im Mittelmeer.
Quelle: ntv.de, Katie Kahle, dpa