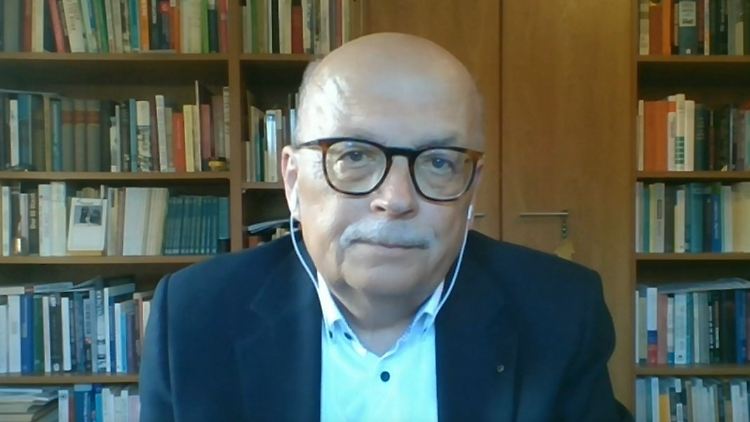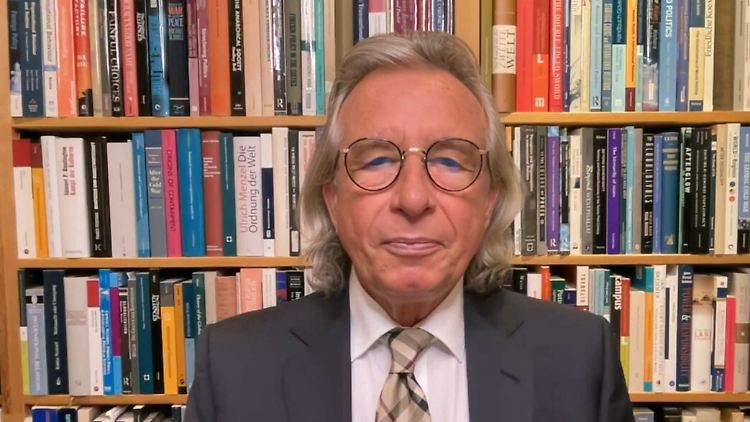Der Haudegen kommt Stabwechsel im Irak
16.09.2008, 13:53 UhrAls General David Petraeus vor 19 Monaten seinen Dienst als Oberbefehlshaber der US-Truppen im Irak antrat, stand das Land an der Schwelle zum Bürgerkrieg. El-Kaida-Terroristen hatten die Anbar-Provinz im Westen des Landes zu ihrer regionalen Operationszentrale gemacht. Schon mehr als 3000 Soldaten der US-Armee hatten damals im Irak ihr Leben verloren. Dann konnte Petraeus mit einer neuen Strategie, zu der mehr Soldaten, neue irakische Hilfstruppen und bessere Aufklärung gehörten, das Blatt wenden.
Doch auch auf seinen Nachfolger, General Raymond Odierno, der seit diesem Dienstag Oberbefehlshaber von rund 146.000 US-Soldaten im Zweistromland ist, kommt noch viel Ärger zu. Vor allem die Provinz Dijala im Nordosten von Bagdad, wo viele ehemalige Offiziere und Angehörige der Geheimdienste von Ex-Diktator Saddam Hussein leben, kommt nicht zur Ruhe. Dutzende von Selbstmordattentätern - Männern und Frauen - haben sich in den vergangenen Wochen in Dijala in die Luft gesprengt. Auch in der Stadt Kirkuk, wo Kurden, Turkmenen und Araber um Macht und Öl kämpfen, ist noch ein Pulverfass zu entschärfen. Viel hängt nach Einschätzung westlicher Beobachter auch davon ab, ob die Regierung von Ministerpräsident Nuri al-Maliki sich eines Tages dazu durchringen wird, gegen das Geschwür der Korruption vorzugehen - auch in den eigenen Reihen.
Lob aus Reihen der alten irakischen Armee
All dies weiß Petraeus sehr genau. Und deshalb warnt der 55-jährige General, dem seine Leistung im Irak eine Beförderung zum Kommandeur für die Region Nah- und Mittelost eingebracht hat, auch in seinem Abschiedsbrief an die Truppe vor lautem, vorschnellem Hurra-Geschrei. Anstatt von "Erfolgen" zu sprechen, lobt der General, der oft das Kalkül eines Politikers hat, lieber die "Verbesserungen": "Obwohl unsere Aufgaben im Irak noch lange nicht vollständig bewältigt sind, und obwohl noch viel harte Arbeit und schwierige Kämpfe vor uns liegen, muss ich sagen, dass Ihr geholfen habt, beachtliche Fortschritte zu erzielen."
Diese Fortschritte würdigen inzwischen selbst Offiziere der alten irakischen Armee, für die das US-Militär seit Beginn der 90er Jahre der ärgste Feind war. "Die US-Truppen haben unter dem Kommando von David Patraeus viel Boden gut gemacht im Irak, besonders in der Stadt Ramadi, die für die amerikanischen Soldaten ein dauerhafter Quell der Sorge war", lobt Ahmed al-Obaidi, ein ehemaliger Oberstleutnant in Saddams Elite-Truppe, der Republikanischen Garde. Er glaubt, dass nicht die vorübergehende Erhöhung der Zahl der US-Truppen, sondern die im Westirak zuerst erprobte Strategie, lokale sunnitische Bürgerwehren für den Kampf gegen El Kaida zu bewaffnen und zu bezahlen, letztlich zum Erfolg geführt hat: "Denn erst das hat den Weg für die irakische Armee und die Polizei freigemacht, die sich dann auch in den Gebieten frei bewegen konnten, die vormals von den bewaffneten Gruppen kontrolliert worden waren."
Bekehrter Haudegen
Der fast gleichaltrige Mann, an den Petraeus jetzt in Bagdad den Stab weiterreicht, gilt als bekehrter Haudegen. General Odierno kommandierte von 2003 bis 2004 eine Einheit, die in den Hochburgen der sunnitischen Aufständischen hart durchgriff. Kurzfristig brachte das zwar damals militärische Erfolge. Und auch die Gefangennahme Saddam Husseins geht auf das Konto seiner Division. Mittelfristig trieben die Soldaten, die dem glatzköpfigen Hünen aus New Jersey unterstellt waren, jedoch durch ihre knallharten Razzien in den Dörfern der Sunniten einige Iraker in die Fänge der El Kaida, die ihnen versprach, Rache an den Amerikanern zu nehmen. Diese Theorie vertreten zumindest etliche Kritiker Odiernos innerhalb und außerhalb der US-Armee.
Dass sich Odierno später der Theorie von Petraeus anschloss, wonach man, um im Irak zu siegen, nicht nur den Kampf, sondern auch das Vertrauen der Menschen gewinnen muss, dazu könnten auch private Erfahrungen beigetragen haben. Sein Sohn, Leutnant Anthony Odierno, verlor durch einen Panzerfaustangriff in Bagdad im Sommer 2004 seinen linken Arm.
Quelle: ntv.de, Anne-Beatrice Clasmann, dpa