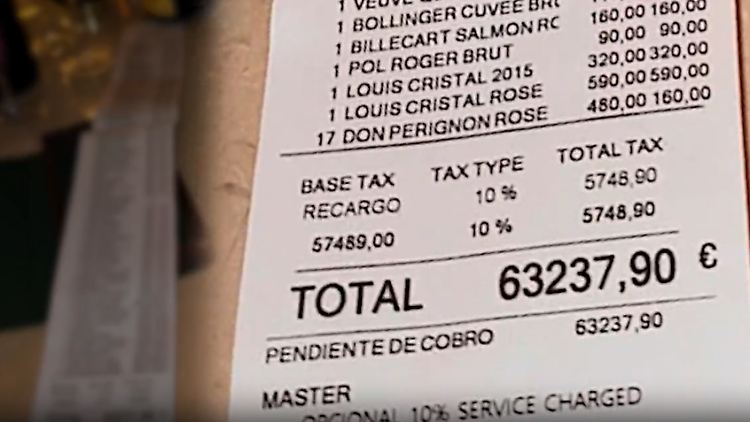Vorbereitung wichtig Anpassung an große Höhen
23.04.2004, 16:21 UhrUnter der Höhenkrankheit versteht man alle Folgen, Symptome und Beschwerden, die aufgrund des in großen Höhen bestehenden geringen Luftdrucks bzw. Sauerstoffpartialdrucks zustande kommen. Es können dies leichte Symptome ab ca. 2000 m bis hin zu schweren Symptomen, wie Lungen- und/oder Hirnödemen, Thrombosen und Lungenembolien in größeren Höhen sein. Die Höhenkrankheit kann in ihrer schweren Form zum Tode führen. Die Betroffenen müssen so schnell wie möglich auf geringere Höhe verbracht werden. Als erste Hilfe bietet sich die Gabe von Sauerstoff oder der Einsatz einer hyperbaren Druckkammer aus aufblasbarem Kunststoff an.
Viele Menschen betreten, meist im Urlaub oder aus sportlichen Gründen, Regionen, in die nur sehr selten Menschen kamen. So werden z. B. Skiurlauber innerhalb von mehreren Minuten mit Seilbahn oder einem Hubschrauber auf Höhen bis über 4000 Meter befördert. Die meisten Menschen gehen ohne irgendeine Anpassung des Körpers in diese Höhe. Auf der starken Steigung der Eisenbahn zwischen Lima (Peru) und La Oroya (Peru) in den Anden müssen die Reisenden, die sich noch nicht an die große Höhe gewöhnt haben, teilweise während der Reise mit Sauerstoff versorgt werden, der aus Flaschen verabreicht wird.
Letztlich ist für alle Symptome und Beschwerden der Höhenkrankheit der Sauerstoffpartialdruck in der atmosphärischen Luft und damit in den Lungenbläschen verantwortlich.
Man unterscheidet im Prinzip vier Zonen, in denen es aufgrund des erniedrigten Sauerstoffdruckes zu unterschiedlichen Reaktionen des Organismus kommen kann. Die individuelle Disposition des einzelnen Menschen und der Grad der Akklimatisation ist zu berücksichtigen :
Indifferenzzone:
Dies ist der Bereich zwischen der Höhe 0 Meter bis 2000 Meter. Physische und psychische Funktion des Menschen sind hier praktisch nicht beeinflusst.
Zone der vollständigen Kompensation:
Diese Zone reicht von etwa 2000 Meter Höhe bis 4000 Meter. Das verminderte Sauerstoffangebot führt bereits ohne körperliche Anstrengungen zu einer Erhöhung der Herzfrequenz, Atemzeitvolumen sowie Herzzeitvolumen. Die psychische und physische Leistungsfähigkeit ist deutlich reduziert.
Zone der unvollständigen Kompensation:
Dieser Bereich erstreckt sich von einer Höhe von etwa 4000 Meter bis ca. 7000 Meter. Ohne Akklimatisation kommt es hier zu erheblichen Störungen, z. B. Bewusstlosigkeit. Die physische und psychische Leistungsfähigkeit ist erheblich reduziert. Auch die Reaktionsfähigkeit nimmt erheblich ab.
Kritische Zone:
Dieser Bereich beginnt in etwa einer Höhe von 7000 Metern. In Bergsteigerkreisen wird hier von Todeszone gesprochen. Ab 7000 Meter wird in der Lunge der kritische Sauerstoffpartialdruck von 30 bis 35 mmHg unterschritten. Wie sehr aber die Symptome von individuellen Besonderheiten abhängen, zeigt das Beispiel des Südtiroler Bergsteiger Messner, der ohne zusätzlichen Sauerstoff den Mount Everest (8840 m) bestieg.
Anpassung:
Der menschliche Organismus besitzt eine erstaunliche Fähigkeit, sich an veränderte Umweltbedingungen anzupassen. So steigt die Zahl der Erythrozyten innerhalb einer Höhe von 4500 Meter wöchentlich um ca. 10 % an. Nach ca. zehn Tagen Aufenthalt ist die „schnelle Anpassungsphase“ der Erythrozytenzahl bereits abgeschlossen. Die Erhöhung der Erythrozytenzahl ist mit einer Erhöhung des Hämatokrit verbunden. Der Hämatokrit ist der Prozentanteil der festen Blutbestandteile (u.a. Erythrozyten, Thrombozyten und Leukozyten) am Blutvolumen. Der Hämatokrit beträgt im Normalfall bei Mann und Frau zwischen 37 und 47 %: Ein erhöhter Hämatokrit bedingt zwar eine bessere Sauerstoffversorgung, kann aber zu Blutflussproblemen führen. Das Risiko von Hirninfarkten, Herzinfarkten und Thrombosen steigt bei erhöhtem Hämatokrit an.
Anpassung an große Höhen:
Durch den Sauerstoffmangel in großen Höhen kann sich im Körper eine s.g. Hypoxie (Sauerstoffmangel im Blut) entwickeln, die viele Körperfunktionen beeinträchtigen kann. Daher ist eine langsame Gewöhnung des Körpers an die sinkenden Luftdruckverhältnisse und das damit verbundene verminderte Sauerstoffangebot bei ansteigender Höhe unbedingt erforderlich.
Das Erkrankungsrisiko ist bei älteren Menschen nicht höher als beispielsweise bei einem 30jährigen. Das Alter ist also kein Hinderungsgrund für eine Reise in höhere Lagen. Sogar Grunderkrankungen (z. B. Bluthochdruck) sind kein Hinderungsgrund, wenn der Patient vom Arzt vor der Reise gut eingestellt ist.
Tipps für Reisende:
-„Climb high, sleep low“: Die Schlafhöhe sollte stets unterhalb der erreichten Tageshöhe liegen. Für die ersten drei Tage keine Schlafhöhe über 3000 Meter wählen.
- Moderater Anstieg, ggf. Ruhetage einlegen.
- Trinken Sie mehrere Liter Flüssigkeit pro Tag und verzichten Sie auf alle Arten von Schlaf- oder Rauschmittel
- Mitunter verschwinden die Symptome bereits nach einigen kräftigen Atemzügen
- Sofortiger Abstieg bei den ersten Symptomen
- Zusätzlich kann – wenn vorhanden – eine Verabreichung von Sauerstoff mittels Atemmaske sinnvoll sein.
- Bei schweren Krankheitsbildern muss unverzüglich ein Arzt aufgesucht werden.
Die Höhenkrankheit
Ein zu schneller Aufstieg und die damit verbundenen Mängel der Adaptation des Körpers an die Höhe, kann zu Beschwerden führen, die zusammengefasst als Höhenkrankheit bezeichnet werden.
Das erste Stadium: „Akute Bergkrankheit“
Am Anfang kann es zu Appetitlosigkeit, Kopfschmerzen, Übelkeit, Erbrechen und Schlaflosigkeit kommen.
Die beste Behandlung in diesem Stadium besteht darin, einen Ruhetag einzulegen. Bei ausbleibender Besserung sollte ein Abstieg und eine Akklimatisierung erfolgen, bis die Beschwerden vollständig abgeklungen sind.
Das zweite Stadium: „Das Höhenlungenödem“
Bei fortschreitenden Beschwerden kommt es zu einer zusätzlichen Flüssigkeitsansammlung in der Lunge, dem s. g. Lungenödem. Typischerweise treten in diesem Stadium starke Atembeschwerden (mit Husten und oft schaumig, weißem Auswurf) und ein extremer Leistungsabfall binnen kürzester Zeit auf. Das Lungenödem kann bereits nach zwei bis vier Tagen auftreten und entwickelt sich oft erst nach einem Aufstieg in Höhen über 3000 Metern.
Die beste Behandlung in diesem Stadium erfolgt durch sofortigen Abstieg bis zur Besserung der Beschwerden. Bei ausgeprägter Symptomatik kann bereits eine medikamentöse Versorgung und eine zusätzliche Sauerstoffbehandlung notwendig sein.
Das dritte Stadium: „Das Höhenhirnödem“
Bei fortschreitender Erkrankung nehmen die Beschwerden zu. Zusätzlich entwickelt sich ein Hirnödem (d. h. Flüssigkeitsansammlung im Gehirn), dass zu Störungen im geordnetem Bewegungsablauf (Ataxien) schwersten Kopfschmerzen bis hin zu Bewusstseinsstörungen und zum Koma führen kann. Zu der Ausbildung eines Hirnödems kommt es meist erst nach einer Höhe oberhalb von 5000 Meter.
Die Behandlung besteht in einer sofortigen Luftevakuierung, medikamentösen Notversorgung und kontinuierlicher Sauerstoffzufuhr.
Quelle: ntv.de