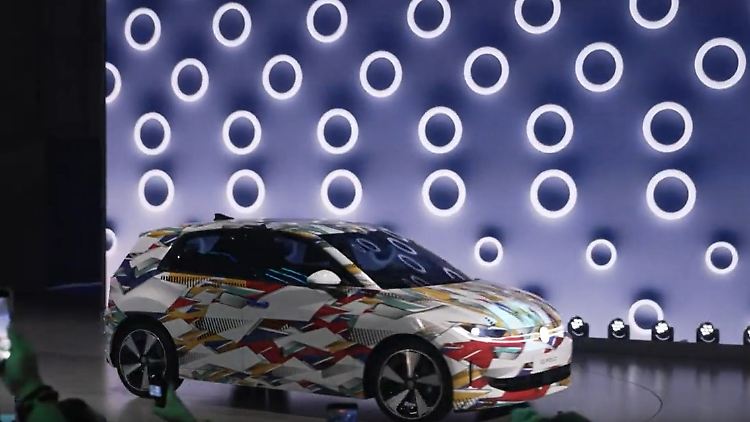Nur ein Objekt pro Ausländer China schottet Häusermarkt ab
15.11.2010, 10:25 UhrDer Zustrom an Kapital aus dem Ausland macht den Marktlenkern in Peking schwer zu schaffen. Um den Preisanstieg bei Immobilien zu dämpfen, greifen die zuständigen Behörden zu groben Methoden.

Überall im Land schießen am Rand der Metropolen Wohnblocks wie Pilze aus dem Boden: Soziale, ökonomische und demografische Bewegungen verändern das Land stärker als je zuvor.
(Foto: REUTERS)
China will Immobilienkäufe durch Investoren aus dem Ausland stark einschränken. Ausländer dürften künftig nur noch eine Immobilie in der Volksrepublik erwerben, teilte die zuständige Aufsichtsbehörde mit. Zudem sei ausländischen Unternehmen der Kauf einer Immobilie nur noch dann erlaubt, wenn sie diese auch selbst nutzten. Diese Einschränkungen sollen einen weiteren Preisanstieg für Häuser und Eigentumswohnungen verhindern. Im Oktober hatten sich die Immobilien in 70 großen Städten um 8,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat verteuert.
Die Beamten bestätigten damit Berichte in staatlichen Medien aus der vergangenen Woche. Mit der Handelsbarriere versucht China, die Spekulation auf dem Häusermarkt in den Griff bekommen. Das Schwellenland stemmt sich derzeit gegen einen übermäßigen Kapitalzufluss aus dem Ausland.
Zugleich wurde bekannt, dass der derzeitige Exportweltmeister seinen Binnenmarkt stärken will. "Die Weltwirtschaft sieht sich noch immer großen Risiken ausgesetzt und hat die schweren Folgen der Finanzkrise noch nicht verdaut", sagte Vize-Ministerpräsident Li Kequing nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Xinhua. Zudem wachse die Gefahr des Protektionismus.
Peking setzt auf heimische Nachfrage
Um ein dauerhaftes Wachstum zu sichern, werde die Regierung deshalb den privaten Konsum stärken. Sie wolle auch weniger in die Wirtschaft eingreifen und stattdessen den Marktkräften mehr Gewicht einräumen. Die Ankündigungen Lis kommen einer weitreichenden politischen Weichenstellung gleich, stehen aber gleichzeitig in Teilen in direktem Widerspruch zum Vorgehen im Immobilienmarkt.
Li kritisierte indirekt auch die lockere Geldpolitik der USA, deren Notenbank insgesamt 600 Mrd. Dollar (rund 439 Mrd. Euro) zusätzlich in die eigene Wirtschaft pumpen will. Kritiker befürchten, dass große Teile des frei werdenden Kapitals in Schwellenländer strömt.
"Einige große Volkswirtschaften setzen auf eine expansive Geldpolitik, um die Konjunktur anzuschieben", sagte Li. "Sie geben dazu große Summen an Liquidität aus, was zu Turbulenzen an den weltweiten Finanzmärkten führen und die Rohstoffpreise nach oben treiben kann." Spekulationsgeld könnte vor allem in die Schwellenländer fließen.
Große Zweifel am Dollar
Nach Ansicht eines führenden Währungshüters muss China seine Abhängigkeit von fremden Währungen wie dem Dollar zurückschrauben. "Das internationale Währungssystem, das auf eine kleine Zahl Reservewährungen konzentriert ist, ist ziemlich instabil", sagte der Vizechef der internationalen Abteilung der chinesischen Zentralbank, Jin Zhongxia. Beunruhigt zeigte sich Jin besonders über den US-Dollar, in dem China einen großen Teil seiner Währungsreserven angelegt hat und der seit drei Monaten an Wert verliert.
Der chinesische Zentralbanker schloss sich der Kritik am geldpolitischen Kurs der USA an. Die Stützungsaktion der Fed bringe "die Wirtschaft in Schwellenländern in ein Dilemma". China hatte bereits in der Vergangenheit kritisiert, die Politik des billigen Dollars berge die Gefahr, dass sich spekulative Fonds auf die Wirtschaft in Schwellenländern konzentrieren. Jin plädierte daher dafür, China müsse sehr viel mehr auf den Yuan setzen, um die eigene Wirtschaft zu stabilisieren.
China und die USA streiten seit Monaten über ihre Währungspolitik. Die USA werfen China vor, den chinesischen Yuan stark unterzubewerten, um billiger in andere Länder exportieren zu können und gleichzeitig Importe aus anderen Staaten teurer zu machen. China wiederum wirft den USA vor, mit ihrer Niedrigzins-Politik und den massiven Eingriffen der Fed im Grundsatz dieselbe Politik zu verfolgen.
Quelle: ntv.de, AFP/rts