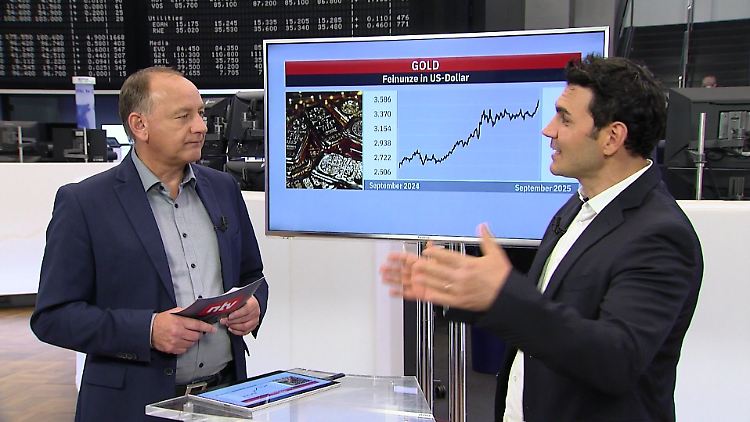Zentralbanker strikt dagegen EWF sorgt für Zündstoff
09.03.2010, 16:10 UhrDie europäischen Währungshüter laufen Sturm gegen die Pläne einer Einführung eines Europäischen Währungsfonds. EZB-Chefvolkswirt Stark spricht von einer "Hängematte für Länder mit finanzpolitischem Schlendrian". Dagegen hält die europäische Politik an dem Vorhaben fest. Laut Kanzlerin Merkel ist der Fonds für die Zukunft gedacht.

(Foto: picture alliance / dpa)
Die Pläne für einen Europäischen Währungsfonds (EWF) sorgen für Verstimmung zwischen Zentralbank und Politik. Mitten in der Schuldenkrise Griechenlands hat die EU den Ruf nach einer europäischen Krisenfeuerwehr erhört - und damit die EZB auf den Plan gerufen. Während die Brüsseler Kommission die Euro-Länder für künftige Krisen mit einem EWF wappnen will, laufen die Hüter des Euro Sturm dagegen.
In den Augen der Befürworter soll der Fonds ein Sicherheitsnetz für Staaten mit ausufernden Defiziten spannen, um in letzter Konsequenz auch einen Staatsbankrott geordnet abwickeln zu können. Für EZB-Chefvolkswirt Jürgen Stark ist das Netz nichts anderes als eine "Hängematte für Länder mit finanzpolitischem Schlendrian". Er sieht gar die Geschäftsgrundlage der Währungsunion in Gefahr.
Auch Bundesbank-Präsident Axel Weber ist kein Freund der EWF-Idee: Es sei wichtiger, den Stabilitäts- und Wachstumspakt zu "härten", anstatt über neue Institutionen zu debattieren, sagte er. Geld dürfe aber in keinem Fall fließen, da ein gegenseitiges Einstehen für die Schulden anderer in den EU-Verträgen ausgeschlossen sei.
Die Notenbanker ziehen damit eine rote Linie und gehen klar auf Distanz zu Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble. Der CDU-Politiker befürwortet für die "innere Statik" der Euro-Zone eine Institution ähnlich dem Internationalen Währungsfonds (IWF). Ein solcher EWF könnte künftig beispielsweise Staatsanleihen pleitebedrohter Staaten aufkaufen und somit die Kosten des Schuldendienstes dem Spiel der Märkte entziehen.
Merkel und Juncker für Fonds
Dagegen verlangen Bundeskanzlerin Angela Merkel und der Vorsitzende der Eurogruppe, Luxemburgs Regierungschef Jean-Claude Juncker, die Schaffung eines Währungsfonds für Europa. "Das ist kein Instrument für Griechenland, sondern das ist in die Zukunft gedacht", sagte Merkel nach einem Gespräch mit Juncker in Luxemburg. Der Fonds solle "nicht ein Instrument sein, das den Eindruck erweckt, nun sei der Stabilitäts- und Wachstumspakt der EU nicht mehr gültig."
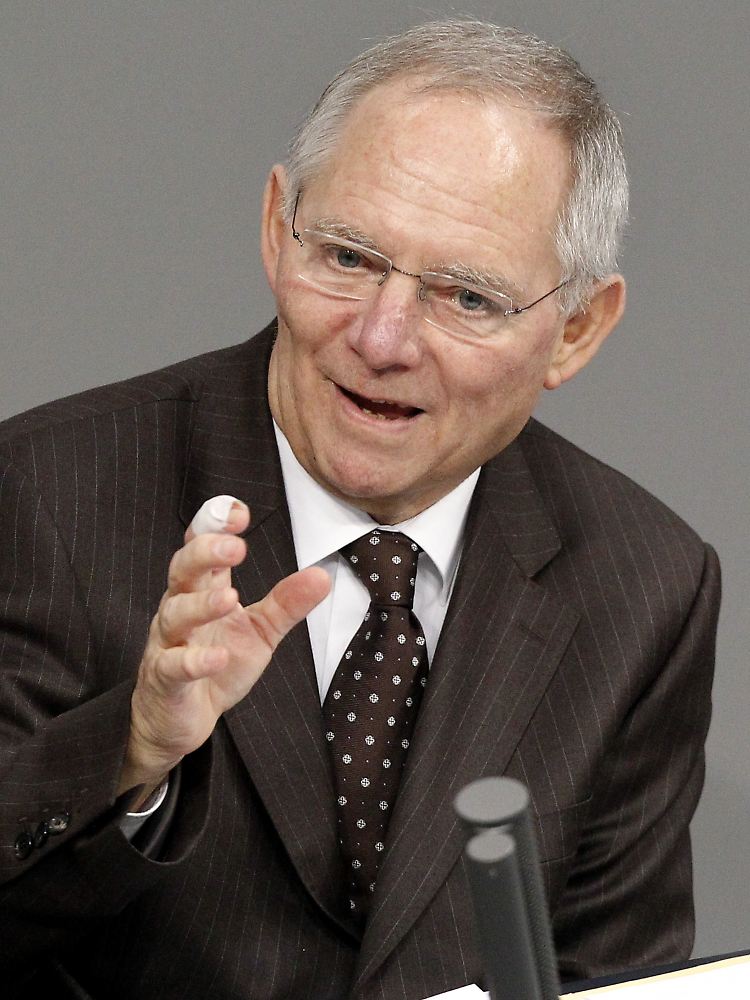
Wolfgang Schäuble will eine "innere Statik".
(Foto: dpa)
Juncker sagte mit Bezug auf die geforderte Haushaltsdisziplin der Eurostaaten: "Das darf aber keine Einladung werden, sich im Sessel zurückzulehnen und in den eigenen Anstrengungen nachzulassen." Niemand solle denken, "dass sich hier eine prinzipielle Möglichkeit für Länder ergibt, die es mit dem Stabilitätspakt nicht so genau nehmen".
Merkel und Juncker kündigten außerdem an, die EU-Statistikbehörde Eurostat solle künftig eine bessere "Einsicht in das Zahlenwerk der einzelnen Nationen" bekommen. Damit soll verhindert werden, dass andere Eurostaaten ebenso wie Griechenland jahrelang gefälschte Zahlen vorlegen. Merkel bedauerte "selbstkritisch", dass Berlin einen entsprechenden Vorschlag 2005 noch abgelehnt habe.
"Gedacht wie eine Feuerwand"
Deutsche-Bank-Chefvolkswirt Thomas Mayer, einer der geistigen Väter der Fonds-Lösung, hält die Gegen-Argumente von EZB-Chefvolkswirt Stark für nicht überzeugend. Der Fonds solle schließlich neben einer Krisenprävention auch konstruktiv die geordnete Abwicklung eines Staatsbankrotts sichern.
"Der Fonds ist gedacht wie eine Feuerwand, die sich zwischen die Märkte und den praktisch insolventen Staat schiebt", sagte Mayer. Ein EWF könne so als Hauptgläubiger gegenüber den betroffenen Ländern auftreten und den Anpassungsprozess selbst steuern. Bislang mangele es an einem Mechanismus für den Fall, dass ein Staat trotz aller Sparanstrengungen den Zahlungsausfall nicht mehr abwenden könne: "Da fehlt ein Glied in der Kette".
Auch der IWF, an dessen Arbeitsweise sich das Konzept eines EWF anlehnt, hat laut Mayer für den Fall eines Staatsbankrotts keine Antworten parat: "Wenn alle Anpassungsprogramme scheitern, geht der IWF nach Hause und überlässt das Land sich selbst. Wir haben gesehen, was dann passiert am Beispiel Argentiniens."
"EZB muss die Kröte schlucken"
Der IWF hat sich allerdings in Europa durchaus Meriten bei der Sanierung von in Bedrängnis geratenen Staaten erworben: Für Ungarn und Lettland spielte der Fonds erfolgreich die Krisenfeuerwehr. Dennoch wollen die Eurozonen-Länder nach Möglichkeit das Problem in der Familie lösen und den als USA-lastig geltenden IWF aus der Krisenlösung heraushalten.
Zuletzt hatte sich der IWF bei den auf Preisstabilität orientierten EZB-Bankern zudem unbeliebt gemacht. Den Vorschlag des Fonds, die Inflationsziele der Notenbanken zu erhöhen, kanzelte Bundesbankchef Weber als "gefährliches Spiel mit dem Feuer" ab.
Nach Einschätzung von Commerzbank-Ökonom Michael Schubert steht die Zentralbank auf verlorenem Posten, falls die Politik die Fondslösung wirklich durchsetzen will: "Die EZB muss die Kröte dann wohl schlucken." Allerdings könnten die Währungshüter bei Gelegenheit eine geldpolitische Antwort geben. "Wenn sich irgendwann herausstellen sollte, dass aufgrund der unsoliden Finanzpolitik in Ländern der Euro-Zone die Inflationserwartungen steigen, muss die EZB handeln und an der Zinsschraube drehen."
Quelle: ntv.de, wne/rts/dpa