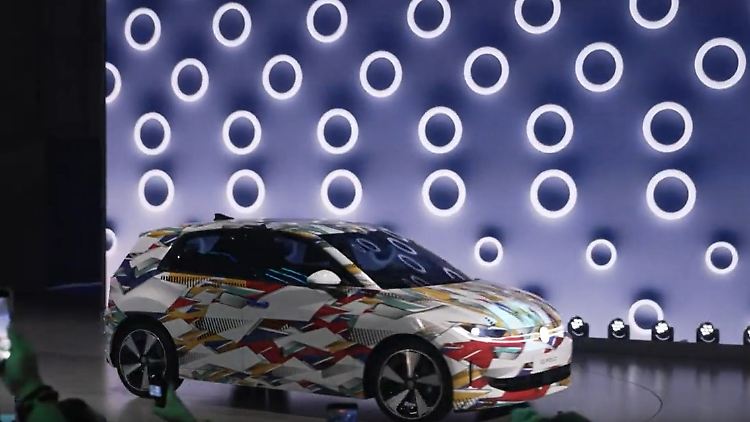Im Schatten der EZB Wozu die Bundesbank?
16.02.2011, 10:19 UhrDer Rückzug Axel Webers von der Spitze der Bundesbank schlägt hohe Wellen. Zugleich wirft er das Licht auf eine angesehene Institution, die jedoch mit der Einführung des Euro ihre wichtigste Aufgabe verloren hat. Wie mächtig und wichtig ist die Bundesbank überhaupt noch?
Fragte man die Deutschen, ob sie statt des Euro die D-Mark wieder einführen wollen, wären wohl zumindest respektable Zustimmungswerte das Ergebnis. Daran ist auch die Bundesbank nicht ganz unschuldig. Mit ihrer stabilitätsorientierten Geldpolitik hat sie mit dafür gesorgt, dass die Mark zu einer harten und verlässlichen Währung wurde - und mit ihrer Ablösung durch den Euro fast zum Mythos. Oder um es mit dem ehemaligen Präsidenten der EU-Kommission Jacques Delors zu sagen: "Nicht alle Deutschen glauben an Gott, aber alle an die Bundesbank".
Ihre Verdienste in allen Ehren, doch die Bundesbank hat ihre Sternstunden wohl hinter sich. Denn der Kern ihrer Macht war die freie Oberhand über die deutsche Geldpolitiik. Mit ihr setzte die Bundesbank ihren Auftrag um, für eine wertstabile Währung zu sorgen und baute sich damit ihre hohe Reputation auf. Ihre Entscheidungen bestimmten nicht nur das Finanzgeschehen in Deutschland, sondern auch in großen Teilen Europas, in denen Richtungsänderungen aus Frankfurt ihren Nachklang fanden. Doch mit der Einführung des Euro liegen die geldpolitischen Entscheidungen nicht mehr bei der Bundesbank, sondern beim großen Bruder, der Europäischen Zentralbank. Dort dürfen die Bundesbanker zwar mitreden, wenn etwa die Leitzinsen geändert werden oder mehr Liquidität für Banken zur Verfügung gestellt wird, doch ihre Stimme ist nur eine unter vielen Zentralbankern aus der gesamten Eurozone.
Am Ende ist auch der Rückzug von Bundesbank-Präsident Weber indirekt diesem Wandel der Bedeutung der Bundesbank zuzuschreiben. Denn Weber sah sich ganz in der Tradition und Verpflichtung seines Hauses mit einer harten Hand gegen die Geldentwertung. Für ihn als Inflations-Falken kam es nicht in Frage, klammen Euro-Staaten mit dem Aufkauf ihrer Staatsanleihen unter die Arme zu greifen. Seine Amtskollegen sahen das jedoch anders, weshalb Weber mit ansehen musste, wie sie gegen seinen Willen die Aufkäufe auf den Weg brachten.
Hüter des Geldes
Allem Machtverlust zum Trotz ist die Bundesbank dennnoch eine wichtige Institution mit bedeutenden Aufgaben. Ihre wohl wichtigste Rolle ist die als Notenbank, die dafür sorgt, dass der Bargeldkreislauf in Deutschland nicht stoppt. Sie organisiert die Versorgung von Banken und Wirtschaft mit Euro-Noten und Münzen und prüft laufend die Qualität des Geldes, das wieder zur Bundesbank zurückfließt. Schmutzige oder kaputte Scheine werden gegen neue ausgetauscht, Falschgeld aus dem Verkehr gezogen. Nicht nur in der Kasse, sondern auch in den virtuellen Bahnen der Bankenrechner stellt die Bundesbank sicher, dass niemand auf dem Trockenen sitzt: Der elektronische Zahlungsverkehr, insbesondere etwa bei großen, grenzüberschreitenden Überweisungen zwischen Banken, läuft über Zahlungssysteme, die auch von der Bundesbank betrieben werden.
Die Bundesbank ist darüber hinaus quasi die "Hausbank" des Bundes. Sie führt die Konten der Behörden von Bund, Ländern und Kommunen sowie den Sozialversicherungen. Auch die Verwaltung der Goldreserven oder die gewinnbringende Wiederanlage der Devisenbestände des Bundes gehört hierzu. Wenn der Bund neue Schulden am Kapitalmarkt aufnimmt, wickelt die Deutsche Finanzagentur die Wertpapiergeschäfte über die Bundesbank ab.
Kontrolle der Banken
Gemeinsam mit der Finanzdienstleistungsaufsicht BaFin überwacht die Bundesbank zudem die mehr als 2000 deutschen Finanzhäuser und sichert damit die Stabilität des deutschen Finanzsystems. Die Bundesbank übernimmt in diesem Tandem die laufende Überwachung der Finanzhäuser, analysiert ihre Jahresabschlüsse und greift für Einzelfallprüfungen zur Lupe. Neben dem isolierten Blick auf die einzelnen Finanzhäuser verfügt die Bundesbank dabei über die wichtige Expertise zur Beurteilung der Stabilität des gesamten Finanzsektors. Auch liefert die Behörde Statistiken zur Lage des Finanzsektors. Hoheitliche Aufgaben jedoch, etwa die Schließung einer Bank oder die Abberufung eines Managers, sind Job der BaFin.
Seit die Bundesbank 1999 die direkte Kontrolle über die Geldpolitik abgegeben hat, musste sie auch personell kräftig Federn lassen. Hunderte Filialen und Tausende Arbeitsplätze wurden in den vergangenen Jahren bereits abgebaut. Damit hat das Institut seiner wandelnden Bedeutung bereits Rechnung getragen. Weiterer Wandel, verbunden mit weniger Arbeitsplätzen und weniger Filialen, werden in den kommenden Jahren folgen. Versuche, der Bundesbank mit einer fokussierten Rolle bei der Bankenaufsicht ein stärkeres Standbein zu geben, scheiterten jedoch bisher weitgehend. Zwar verbinden Befürworter einer großen Finanzaufsicht mit den Plänen weniger Kompetenzstreitigkeiten und effektivere Kontrolle. Doch Sorge vor einem Verlust der Unabhängkeit der Bundesbank überwogen am Ende, da die Bankenaufseher unter dem Dach der Notenbank im Zweifel auch auf staatliche Anweisung hin handeln müssten.
Ihre Unabhängigkeit hat die Bundesbank einst zu Ansehen und Einfluss verholfen. Nun geht es für die Notenbank darum, diesen Trumpf trotz ihrer neuen Rolle als Gleicher unter Gleichen nicht aus der Hand zu geben. Eine starke, unabhängige Bundesbank als deutscher Beitrag zu einer Stabilitätskultur für den Euro ist das, was die Bundesbank auch in Zeiten des Eurosystems zu einer wichtigen Institution macht.
Quelle: ntv.de