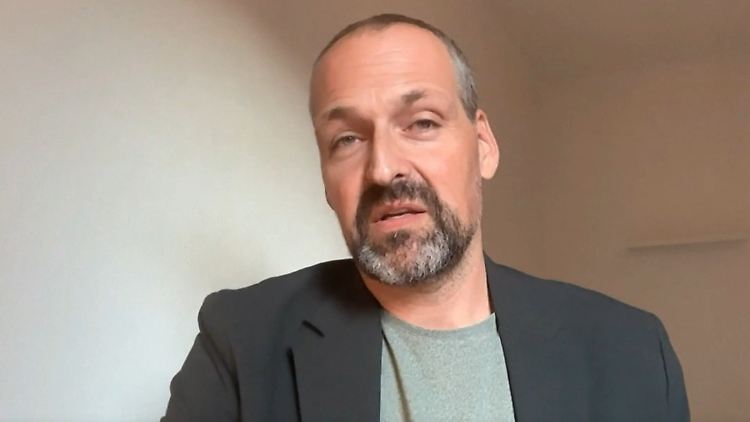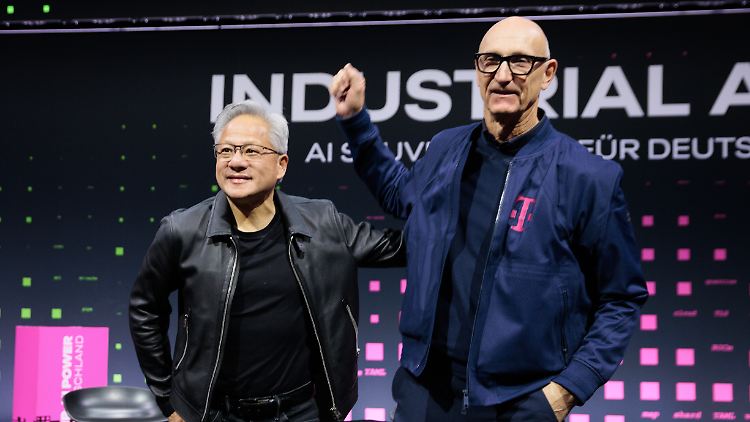Continental GT V8 So fährt der Vierzylinder-Bentley
21.02.2012, 14:37 Uhr
Mit dem V8-Motor hat Bentley 40 Prozent Verbrauchsminderung gegenüber dem 12-Zylinder realisiert.
(Foto: Dominik Frazer)
Die Verringerung der Zylinderzahl soll beim neuen Bentley Continental GT auch zu einer Wesensänderung führen: Nach der Marketing-Prosa des Herstellers wirkt das mondäne Luxus-Coupé künftig "cool" und "extrovertiert", der Preis ist aber mehr als bürgerlich-konservativ: knapp 162.000 Euro.

Gut verpackt präsentiert sich der Vierliter-Motor mit innovativer Zylinderabschaltung.
(Foto: Dominik Frazer)
Auch im 93. Jahr des Bestehens der Firma fühlen sich die Nachfahren Walter Owen Bentleys dem vom Firmengründer postulierten Idealbild von der "anstrengungslosen Beschleunigung" verpflichtet. Doch der Überfluss von allem ist für die Luxusmarke offenbar nicht mehr selbstverständlich. Mit vier Zylindern und zwei Liter Hubraum weniger soll man auch noch ganz gut unterwegs sein, verspricht das neue Modell Continental GT. Ein V8 ist für sich genommen immer ein veritables Antriebsaggregat, aber mitunter wird das Coupé sogar nur mit vier Zylindern unterwegs sein.
Technisches Herz ist ein gemeinsam mit Audi entwickelter V8-Zylindermotor, den die Ingolstädter inzwischen in ihrer Sportlimousine S8 einbauen. Aus vier Litern Hubraum holt der Bentley 507 PS. Im Vergleich mit dem W12-Zylindermotor des ersten Continental bedeutet dies eine deutlich höhere Literleistung, also dem Verhältnis von Hubraum zur erzielten Motorkraft. Aktuell bieten die sechs Liter großen Zwölfzylinder 575 PS an, was einer Leistung von 95,8 PS je Liter Hubraum entspricht. Der vier Liter große Achtzylinder kann dagegen mit einer Literleistung von 126,7 PS aufwarten. Gleichzeitig liegt das maximale Drehmoment des kleineren und deshalb rund 25 Kilo leichteren Motors mit 660 Newtonmetern schon ab 1 700 Umdrehungen an, und damit sehr nahe an den 700 Newtonmetern, die der Zwölfzylinder zur Verfügung stellt.
Neuerdings ein bisschen frech
Hubraum und Drehmoment im Überfluss waren es, was die Marke seit den 20er Jahren des vorigen Jahrhunderts ausgemacht, ihr legendäre Rennsiege eingebracht und die zahlungskräftige Kundschaft begeistert hat. Und nun hat sich auch ringsherum allerlei geändert. "Produktpositionierung" nennen das die Fachleute. Das Markenlogo, das geflügelte B, ist nun aggressiv rot unterlegt, das Fahrzeug sei "cool" und "extrovertiert" sagen die ehemaligen Understatement-Künstler. Das Design des Informationsmaterials, die Werbebilder, die Schrift der Slogans – alles ist nicht mehr so abgehoben mondän gestylt, sondern wirkt modern, weltoffen und ein bisschen frech.
Dass dies mit dem neuen Technikvorstand zu tun habe, diesen Kalauer wird Entwicklungschef Rolf Frech wohl noch das eine oder andere Mal hinnehmen müssen, aber der Imagewandel, den das neue Produkt einläutet, ist präzises Kalkül: Es gibt offenkundig genügend wohlhabende jüngere Leute, die Bentley noch nicht als Kunden gewonnen hat. Die fahren bisher lieber Maserati oder Aston Martin, ihnen gilt der distinguierte Charme britischen Landadels zwar als edel, aber hausbacken.
Die zu erzielende Fahrleistungen liegt nur unwesentlich unter denen der bisherigen Continental-Modelle. Mit 303 km/h wird die schon aus Imagegründen nicht zu vernachlässigende 300 km/h-Marke sicher überschritten. Noch besser fürs Image ist der Verbrauch. Bentley kann in der Werbung mit dem stattlichen Wert von 40 Prozent Ersparnis werben, was zu einem EU-Normwert vom 10,5 Litern auf 100 km führt. Zwar kann der verringerte Hubraum nur zu 16 Prozent an der Gesamtreduzierung mitwirken, Maßnahmen wie Rekuperation und eine elektrische Servolenkung sowie rollwiderstandsreduzierte Reifen helfen mit. Technisch anspruchsvoll und innovativ in der Klasse der Luxus-Coupés ist die Zylinderabschaltung, die dafür sorgt, dass in dem Bentley bei geringer Lastanforderung nur vier Zylinder aktiv sind.
Vier Zylinder vorübergehend stillgelegt

Trotz 2,3 Tonnen Gewicht schafft es der Bentley unter fünf Sekunden auf 100 km/h.
(Foto: Dominik Frazer)
Die Abschaltung der Zylinders bei mittlerer oder geringer Last sowie im Schubbetrieb erfolgt über die Ventilsteuerung. Öffnen und Schließen der Ventile wird normaler Weise über die Profile der Nockenwelle gesteuert. Die Nockenwelle des neuen Motors trägt zusätzliche Hülsen, die elektromagnetisch verschoben werden können. Die Verschiebung bewirkt, dass so genannte Nullhubprofile über den Ein- und Auslassventilen rotieren. Die Ventile bleiben also geschlossen, gleichzeitig ist die Direkteinspritzung deaktiviert. Da es kein Gemisch zu zünden gibt, unterbleibt auch dies und die Kolben werden in leeren Zylindern nur von der Kurbelwelle bewegt. Angenehmer Nebeneffekt: In den aktiven Zylindern steigt der Wirkungsgrad, weil sich die Betriebspunkte zu höheren Lasten hin verlagern. Sobald der Fahrer wieder Gas gibt, werden die Hülsen zurück verschoben und die abgeschalteten Zylinder damit wieder aktiviert.
Dass der Continental GT trotz aller vehementer Kraftentfaltung und mächtigen Schubs schon bei geringer Drehzahl eben doch kein lupenreiner Sportwagen ist, merkt man auf dem Rundkurs. Dort spielt er zwar gern und eindrucksvoll seine schiere Kraft und seine gewaltige Durchzugskraft aus, lässt die Auspuffanlage in herrlicher tiefer Klangfarbe brüllen und versetzt die Insassen in einen rauschhaften Zustand aus Längs- und Querbeschleunigung. Aber er kann nicht seine 2,3 Tonnen Leergewicht verschleiern, den unbedingten Drang zum Kurvenaußenrand und die satte Neigung der Karosserie, die bei hohem Tempo in Kurven drängende Fragen der Fahrstabilität aufzuwerfen scheint. Natürlich geht er sicher auch um die spitzeste Haarnadelkurve, faucht sich in das nächste Drehzahlhoch, doch der Wunsch nach härterer Dämpfung will nicht weichen, obwohl das adaptive Fahrwerk längst im "Sport"-Modus unterwegs ist.
Vorn ein halber Zentner weniger
Die Wahl der passenden Übersetzung ist einem Achtgang-Getriebe von ZF überlassen, das in ähnlicher Form bereits in zahlreichen Erzeugnissen deutscher und englischer Fahrzeugmanufakturen seinen Dienst tut. Es ist durch viel Drehmoment nicht in Verlegenheit zu bringen, schaltet sanft und nötigenfalls auch über mehrere Gangstufen nach unten und ist – zumindest bei anderen Marken – in vollem Umfang Start-Stopp-tauglich. Leider nicht bei Bentley. Je nachdem, wen man aus der Ingenieursriege um Erläuterung dazu bittet, erhält man die Antwort, "unsere Kunden mögen das nicht" oder, "das war auf der vorhandenen Elektronik-Plattform nicht realisierbar".
Aber ein Bentley hat nicht in erster Linie den Motor abzuschalten, sondern komfortabel zu sein und in in zweiter Linie temperamentvoll. Bretthart kann man ihn nicht bekommen, den Continental GT, denn er soll nicht die letzten Zehntel aus dem Rundkurs zu holen, sondern souverän die Konkurrenz in Schach halten, die im Zweifelsfalle als Hecktriebler nicht seine überzeugenden Traktionsqualitäten bieten können.
Immerhin lasten gegenüber dem Zwölfzylinder-Bruder 25 Kilogramm weniger auf der Vorderachse, was die Aufgaben der Servolenkung vereinfacht, sie leichtgängig und rückmeldungsfreudiger macht. Doch wenn man rund 700 Kilogramm mehr Gewicht als zum Beispiel ein 911er Coupé auf die Strecke wuchtet, kann das trotz aller versammelten Motorkraft nicht ohne Folgen bleiben. Letztlich erwarten die Kunden vom GT und GTC eine kommode Fortbewegungsart. Die Fähigkeit, unsanfte Huckel der Fahrbahn auszubügeln ist besser ausgeprägt als die Suche nach der Ideallinie bei Höchstdrehzahl. Nicht zuletzt der Marketingstrategie ist die Tatsache geschuldet, dass die Spreizung zwischen maximal sanfter und härtester Dämpfereinstellung nur wenig über der Wahrnehmbarkeitsschwelle liegt: Es muss auch noch Platz für ein "Speed"-Modell sein, dass nicht nur bald kommen, sondern auch noch allerlei Karbon-Teile als äußeres Zeichen seiner Rennsport-Verwandtschaft mitbringen wirdf
Quelle: ntv.de