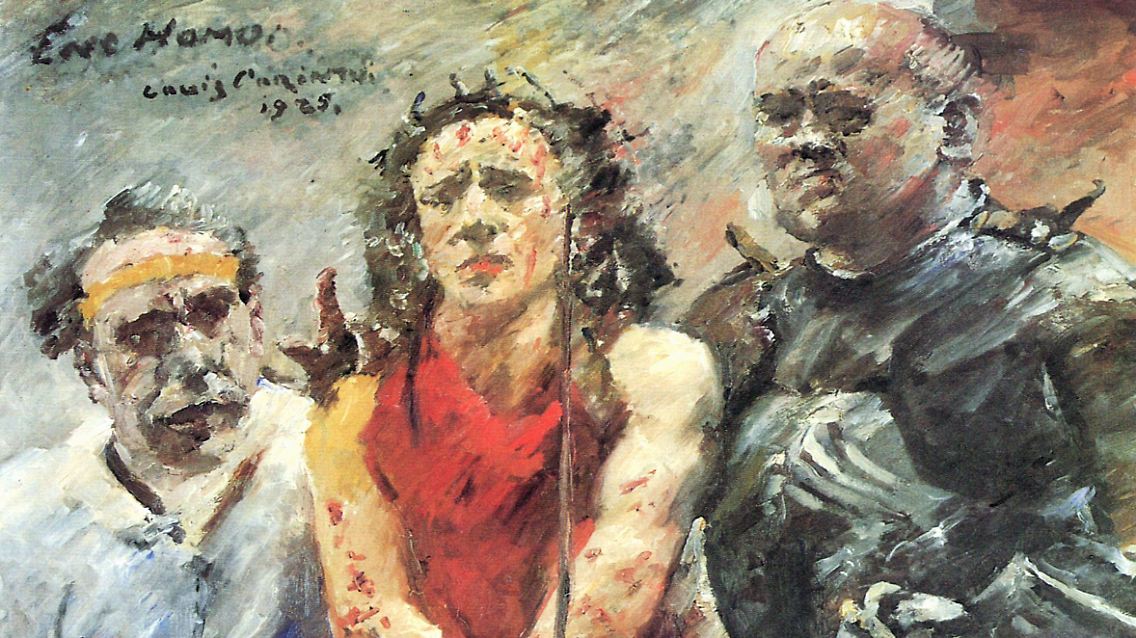Noch mehr von Nazis geraubte Kunstwerke? Bundesregierung wusste Bescheid
04.11.2013, 10:18 Uhr
In diesem Münchner Mehrfamilienhaus machten die Zollfahnder den Sensationsfund.
(Foto: imago stock&people)
1500 Bilder von Picasso, Matisse, Chagall und anderen Meistern der klassischen Moderne entdeckt der Zoll 2011 in einer Münchner Wohnung. Der Fall ist so spektakulär, dass auch die Bundesregierung informiert wird. Die meisten Werke haben die Nazis jüdischen Sammlern geraubt. Doch das scheint längst nicht alles zu sein, was Cornelius Gurlitt verbirgt.
Die Bundesregierung weiß bereits seit längerer Zeit über den Fund von etwa 1500 bislang verschollenen Gemälden von Meistern der klassischen Moderne in München Bescheid. "Die Bundesregierung ist seit mehreren Monaten über den Fall unterrichtet", sagte Regierungssprecher Steffen Seibert in Berlin. Durch die Vermittlung von Experten, die sich mit "Entarteter Kunst" und von den Nationalsozialisten geraubter Kunst auskennen, würden die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Augsburg auch unterstützt.
Weiter sagte Seibert, er habe "keine Informationen" darüber, ob aus dem Ausland bereits Besitzansprüche geltend gemacht worden seien. Das Finanzministerium verwies nur darauf, dass die Staatsanwaltschaft Augsburg für alle Auskünfte zuständig sei. Die Staatsanwaltschaft äußert sich zu dem Fall allerdings nicht.
Weitere Lager?
Zoll-Ermittler hatten in einer Wohnung in München etwa 1500 Werke von Meistern der Klassischen Moderne entdeckt, darunter verschollen geglaubte Werke von Künstlern wie Pablo Picasso, Franz Marc oder Max Beckmann. Möglicherweise verfügt Cornelius Gurlitt, in dessen Wohnung die Zollfahnder fündig wurden, über weitere bisher unentdeckte Bilderdepots. Dies belegen Recherchen des "Focus", der den Fall aufgedeckt hatte.
Der 80-Jährige habe ein halbes Jahr nach der Beschlagnahmungsaktion in der Schwabinger Wohnung dem Auktionshaus Lempertz ein Kunstwerk von Max Beckmann zum Verkauf angeboten. Das großformatige Werk "Löwenbändiger" aus dem Jahr 1930 galt ebenfalls seit Jahrzehnten als verschollen.
Das Bild wurde 2011 zunächst aufgerufen, dann aber aus der Aktion genommen, weil die Erben des Kunsthändlers und Sammlers Alfred Flechtheim Anspruch auf das Werk erhoben. Flechtheim war vor den Nazis über Paris nach London geflohen und hatte sowohl den Kunstbestand seiner Galerie als auch seine private Sammlung weit unter Wert verkaufen müssen. Der "Löwenbändiger" ging an die Flechtheim-Erben zurück und wurde später für 864.000 Euro versteigert. Insider gehen davon aus, dass Gurlitt etwa die Hälfte der Summe erhielt. Dies liegt daran, dass die Konfiszierung "entarteter Kunst" durch ein Reichgesetz gedeckt war und damit bis heute als rechtmäßig gilt.
Auf der Rückseite des Bildes waren die Eigentumsverhältnisse klar belegt. Laut einem Aufkleber gehörte das Bild 1931 der Galerie Alfred Flechtheim (Berlin), seit 1934 Dr. Hildebrand Gurlitt, dann Helene Gurlitt, München (1967), "seitdem Familienbesitz Süddeutschland". Hinter dieser Formulierung verbirgt sich offenbar Cornelius Gurlitt.
Unsachgemäß gelagert
Die Mitarbeiter des Auktionshauses berichteten dem "Focus", dass der "Löwenbändiger" in einem sehr schlechten Zustand gewesen sei. "Das Papier habe mehrere Risse aufgewiesen, der Rahmen sei nur noch Schrott gewesen. Offenbar sei das Kunstwerk über viele Jahre hinweg achtlos und unsachgemäß gelagert worden." Da zu diesem Zeitpunkt alle Kunstwerke aus der Münchner Wohnung bereits im Sicherheitstrakt des bayerischen Zolls in Garching bei München lagerten, muss das Bild anderswo her stammen.
Nach dem Krieg hatte der Vater von Cornelius Gurlitt, ein Kunsthändler in Diensten der Nationalsozialisten, behauptet, die Meisterwerke seien nach einem Bombenangriff in seiner Dresdner Wohnung verbrannt. Tatsächlich befanden sie sich jedoch weiter in Familienbesitz. Die Ermittler gehen davon aus, dass Cornelius Gurlitt immer wieder einzelne Bilder verkauft und von den Erlösen gelebt hat. Leere Rahmen und diverse Dokumente belegten dies. Zur Last wird ihm gelegt, dass er auf diese Verkäufe keine Steuern gezahlt hat.
Als die Fahnder die Wohnung in einer mehrtägigen Aktion leer räumten und die Kunstwerke abtransportierten, darunter Werke von Pablo Picasso, Henri Matisse, Marc Chagall, Emil Nolde, Franz Marc, Max Beckmann oder Max Liebermann, habe der Mann keinen Widerstand geleistet. Die Mühe hätten sich die Fahnder sparen können, er würde doch ohnehin bald sterben, soll er gesagt haben. Die Bilder könnten mehr als eine Milliarde Euro wert sein.
Quelle: ntv.de, sba