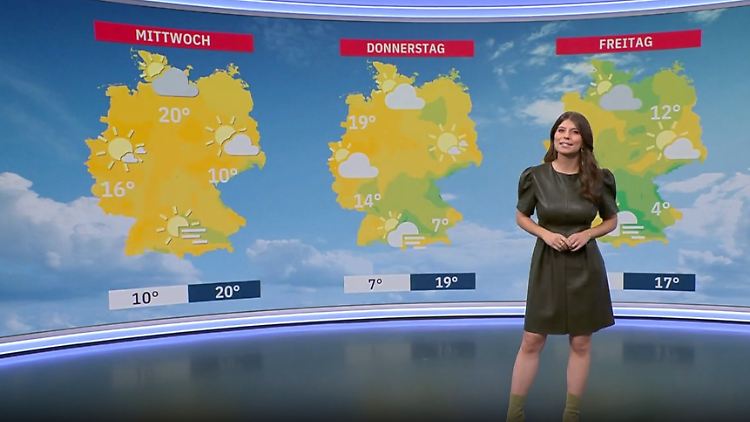Uli Hoeneß und die Folgen Die klare Botschaft eines ungewöhnlichen Verfahrens
13.03.2014, 20:27 Uhr
Wollen in Revision gehen: Uli Hoeneß und seine Verteidiger.
(Foto: AP)
Uli Hoeneß hat darauf gesetzt, dass das Gericht ihm seine rückhaltlose Offenheit zugute hält. Das ist nicht geschehen, jedenfalls nicht im von Hoeneß erhofften Maße. Richter Heindl warf dem Bayern-Präsidenten vor, mit der Selbstanzeige gezockt zu haben. Dass der BGH diese Frage nun klären wird, ist gut. Dennoch hält das Urteil eine klare Botschaft bereit.
Wie die Urteilsbegründung im Prozess gegen den FC-Bayern-Präsidenten Uli Hoeneß soll dieser Kommentar eine Vorbemerkung bekommen. Richter Rupert Heindl hatte am Donnerstagnachmittag im Münchner Justizpalast kritisiert, dass die Journalisten, die über das Verfahren berichteten, dies nicht immer mit der gebotenen Zurückhaltung getan hätten. Eines soll hier klargestellt werden: Der Verfasser dieser Zeilen ist kein Jurist. Den juristischen Wert des Urteils will und kann er nicht kommentieren. Hier wird weder verkündet, dass "Hoeneß in den Knast" gehört, noch wird hier "Freiheit für Uli Hoeneß" gefordert.
Jeder Prozess hat eine juristische und eine, nun ja, menschliche Seite. Menschlich war das Verfahren gegen Hoeneß überschaubar. Der Bayern-Präsident hat mit einem Schweizer Konto an der Börse gezockt, die Versteuerung seiner Gewinne ist ihm, so hat er es dargestellt, nicht in den Sinn gekommen. Für Unterlagen über seine Kontobewegungen hat er sich nie interessiert. Wenn er doch mal daran gedacht haben sollte, zur Steuerehrlichkeit zurückzukehren, wie es so schön heißt, dann hat er diesen Gedanken vermutlich rasch beiseite geschoben - so, wie Normalbürger den Gedanken an ihre Steuererklärung mitunter beiseite schieben. Und die ungeliebte Arbeit dann trotzdem in Angriff nehmen.
Das ist, je nach Standpunkt - wahrscheinlich auch je nach individueller Haltung zum deutschen Rekordmeister - eine Position, die man nachvollziehen kann. Oder eben nicht. Richter Heindl fand sie nicht überzeugend, aber selbst wenn er sich der Position Franz Beckenbauers angeschlossen hätte, "der Uli" sei nun mal ein "Schlamper", dann hätte dies sein Urteil wohl kaum beeinflusst. Es werde manchmal vergessen, dass Steuerhinterziehung ein Vorsatzdelikt ist, sagte Heindl. Mit anderen Worten: Wer Steuern hinterzieht, kann ein Narzisst, ein Zocker oder ein Schlamper sein. Die Gerichte werden dennoch von Vorsatz ausgehen.
Erst zu lange gewartet, dann ein bisschen Pech gehabt
Im Zentrum des Verfahrens stand die Frage, ob Hoeneß' Selbstanzeige vom Januar 2013 vom Gericht als gültig angesehen werden muss. Darüber entscheidet nicht das Mitgefühl, sondern das Gesetz. Paragraph 371 der Abgabenordnung besagt, dass ein Steuersünder nach einer wirksamen Selbstanzeige straffrei bleibt. Hoeneß hat seine Selbstanzeige jedoch in aller Eile verfassen lassen; unstrittig war im Verfahren, dass sie unvollständig war. Er setzte daher im Verfahren auf rückhaltlose Offenheit. Dies half ihm nur zum Teil. Die Staatsanwaltschaft räumte ein, dass ohne diese Offenheit nicht die gesamte Steuerschuld aufgeflogen wäre. Doch wer wisse denn, ergänzte Heindl, ob nicht irgendwann eine Steuer-CD der Hoeneß-Bank Vontobel auftauchen werde.
Im langen Zuwarten des Uli Hoeneß sah Heindl den hauptsächlichen Grund für das Scheitern der Selbstanzeige. Die Verteidigung bestreitet, dass die Selbstanzeige gescheitert ist, sie spricht von einer "verunglückten" oder "nicht idealen Selbstanzeige". Die Urteilsbegründung legt nahe, dass diese Ansicht nicht vollständig absurd ist. Rechtsanwalt Hanns W. Feigen sagte, die Verteidigung werde in Revision gehen, der Bundesgerichtshof müsse den Fall nun klären. Unabhängig von Hoeneß' persönlichem Schicksal wäre dies zweifellos sinnvoll. Heindl hat zugestanden, dass dieser Fall ziemlich ungewöhnlich ist - er äußerte sogar die Vermutung, dass andere Finanzämter als das in Miesbach eine solche Selbstanzeige möglicherweise akzeptiert hätten. Ein bisschen hatte Hoeneß auch einfach Pech.
Da war Heindl, vielleicht ohne dies selbst zu wollen, nicht weit weg von Anwalt Feigen. Der hatte im Verfahren darauf hingewiesen, dass es höchst ungewöhnlich sei, dass zwei Oberstaatsanwälte den zuständigen Staatsanwalt zu einem Termin beim Finanzamt begleiten. Indirekt unterstellte er der Staatsanwaltschaft, Hoeneß besonders scharf verfolgt zu haben.
"Keine Gleichbehandlung im Unrecht"
Dies allerdings ließ Heindl nicht gelten. Aus eigener Schuld habe Hoeneß nicht das notwendige Material für eine wirksame Selbstanzeige gehabt, sagte der Richter, "aber Sie haben es trotzdem riskiert". Bei einem anderen Finanzamt hätte dies möglicherweise gut gehen können, so die unausgesprochene Botschaft. Aber "es gibt keine Gleichbehandlung im Unrecht". Andere Steuerhinterzieher mögen mit einer unwirksamen Selbstanzeige bereits durchgekommen sein, sollte das heißen. Hoeneß kann daraus aber keinen Anspruch ableiten.
Zu klären ist nun vom BGH, ob die Regeln für die Selbstanzeige so scharf sind, wie Heindl meint. Für Steuerhinterzieher hat allerdings auch sein noch nicht rechtskräftiges Urteil eine klare, auch für Laien verständliche Botschaft: Wenn es zum Prozess kommt, dann reicht es nicht, wenn man behauptet, man habe eigentlich all die Jahre steuerehrlich werden wollen. Wer für seinen eigenen Fall jetzt auf Hoeneß' Revision hofft, der könnte sich schwer verzocken.
Quelle: ntv.de