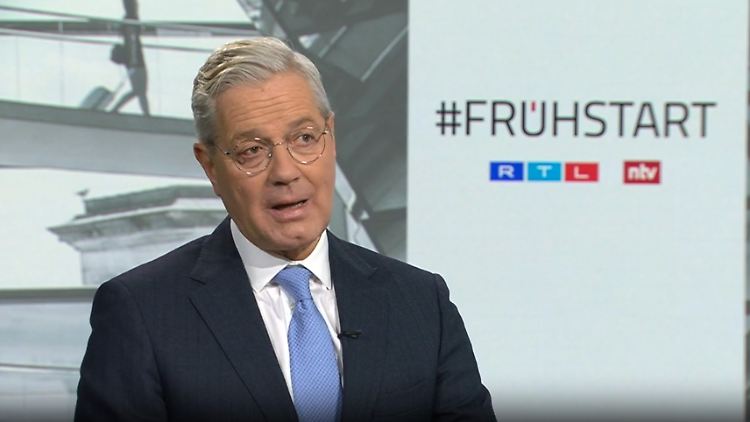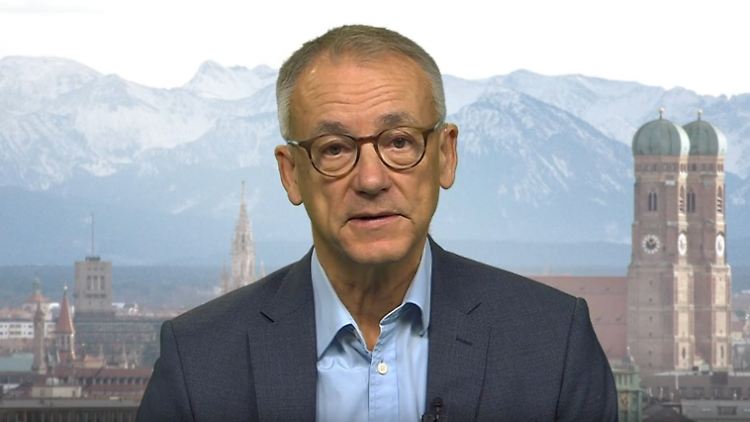Parlamentswahl in Afghanistan "Aufständische gewinnen an Einfluss"
18.09.2010, 09:20 Uhr
Schule ja, Frieden nein. Afghanische Kinder leiden besonders unter dem Krieg.
(Foto: REUTERS)
Afghanistan wählt sein Parlament. Doch mit der Demokratie ist kein Frieden eingekehrt, keine Sicherheit und keine Gesundheit. Die Versorgung der Bevölkerung ist noch immer schlecht, vor allem in den entlegenen Regionen. Marianne Huber ist eine der mutigen Menschen, die Abhilfe schaffen. Die 57-jährige Schweizerin, die ihre Jugend im Iran verbrachte, arbeitet seit mehr als einem Jahr für die Hilfsorganisation Caritas international in Afghanistan. Sie sieht das Leid der Bevölkerung und hat die Zuversicht trotzdem nicht verloren.
n-tv.de: Sie arbeiten seit gut einem Jahr in Afghanistan. Was war damals Ihre Motivation, dorthin zu gehen?
Marianne Huber: Ich bin im Iran aufgewachsen, also im Nachbarland, in einer ähnlichen Region. Daher kannte ich die Sprache, die Kultur, die Religion. Außerdem habe ich schon in vielen Krisengebieten gearbeitet. Diese Erfahrungen wollte ich hier einbringen, in einem Land, das für humanitäre Hilfe sehr anspruchsvoll ist.
Wie sieht ein normaler Tag bei Ihnen aus, falls es so etwas gibt?
Doch, so etwas gibt es schon. Mein Hauptarbeitsplatz ist das Caritas-Büro in Kabul. Unser Haus ist ummauert und von Stacheldraht umgeben. Die Gegend hier ist aber sehr angenehm, es ist eher ruhig und wir sind nicht direkt bei den Ministerien, die wir als NGO meiden. Ich arbeite hier mit einem Team von zehn Afghanen und einem Indonesier. Es geht darum, unsere Programme, die wir hauptsächlich im Hochland durchführen, zusammen mit unseren afghanischen Partnern zu planen und zu koordinieren. Und dann gibt es immer mal wieder zehntägige oder längere Reisen in die Gebiete, in denen wir arbeiten, vor allem im Hazarajat. Da schaue ich mir dann die Projekte vor Ort an.
Arbeiten Sie auch mit dem Militär zusammen?
Nein, überhaupt nicht. Es gibt zwar informelle Kontakte, aber wir arbeiten grundsätzlich ohne Waffen und ohne den Schutz des Militärs. Es deprimiert mich, dass die Unabhängigkeit der humanitären Organisationen durch die Forderung des deutschen Entwicklungsministeriums, man solle quasi mit dem Militär unter einem Dach arbeiten, erschwert wird. Das ist einfach nicht möglich, wir müssen unparteiisch sein. Ich kenne auch einige humanitäre Organisationen, die in Gebieten arbeiten können, wo die Taliban dominieren. Das geht aber nur, wenn man sich seine Unabhängigkeit bewahrt.
Man hört, dass sich die Sicherheitslage in letzter Zeit verschlechtert hat. Wie erleben Sie das in Kabul oder auf Ihren Reisen durchs Land?
Ich kann ganz klar sagen, dass es in Kabul selbst sicherer geworden ist. Die Sicherheitsmaßnahmen wurden intensiviert und das merkt man auch. Die Frequenz der schweren Anschläge hat in der letzten Zeit abgenommen. Aber das ist natürlich mit einem enormen Aufwand verbunden. Im restlichen Land wird es zunehmend unsicher. Die Aufständischen gewinnen an Einfluss, breiten sich aus und kontrollieren ganze Gebiete. Für uns heißt das zum Beispiel, dass wir nicht mehr über Land in unsere Projektregionen fahren können. Im letzten Herbst konnten wir das noch. Jetzt müssen wir eine Strecke fliegen, weil das Fahren zu riskant ist. Es kann immer Anschläge geben.
Sie arbeiten für eine westliche Hilfsorganisation. Wie begegnet man Ihnen in Afghanistan?
Im direkten Kontakt mit unseren afghanischen Partnern und der Bevölkerung in unseren Projektgebieten spüren wir keine Ablehnung. Man kennt sich, es besteht eine Vertrauensbasis durch die jahrelange Zusammenarbeit. Aber wir arbeiten eben auch nur da, wo wir willkommen sind. Wir können und wollen nicht da arbeiten, wo man uns von vornherein feindselig begegnet.
Hat sich die geplante Koranverbrennung des US-Pastors Terry Jones auf Ihre Arbeit ausgewirkt?

Marianne Huber arbeitet seit Juni 2009 in Afghanistan. Zuvor war sie als Helferin unter anderem im Sudan und in Somalia.
(Foto: Caritas international)
Die Sache hat hier Besorgnis ausgelöst, sowohl bei den Afghanen als auch bei uns. Wir haben befürchtet, dass es dadurch zu einem Flächenbrand kommt, in dem alles Westliche, alles Christliche und Ausländische angegriffen wird. Zwei Tage bevor diese Aktion stattfinden sollte, habe ich an einer Moschee hier in der Nähe ein Flugblatt gesehen, wo zu einer Demonstration aufgerufen wurde. Da war die Rede von christlicher Kolonialisierung in all ihren Formen, militärisch und ideell. Was für uns einfach die Aktion einer verrückten Sekte ist, empfinden manche hier als Teil eines christlichen Angriffs auf den Islam. Es wird einfach von gewissen Kräften in diesem Land überhaupt nicht differenziert.
Kann man diese Unfähigkeit zu differenzieren nicht verstehen, angesichts der Situation der Bevölkerung?
Verstehen kann man das schon. Das Land ist einfach in einem ungeheuren Spannungsfeld zwischen Moderne und Tradition, die Menschen wissen nicht, wie sie auf die Veränderungen reagieren sollen. Es herrscht eine sehr große Unsicherheit, niemand weiß, was morgen sein wird, was in einem Jahr sein wird. Die Kinder gehen jetzt zur Schule, wachsen in eine neue Zeit. Aber die Bevölkerung befindet sich, abgesehen von den wenigen wohlhabenden Menschen, immer noch in einem täglichen Überlebenskampf. Hinzu kommt, dass die westlichen Mächte als Unterstützer der Regierung von Karsai gesehen werden. Und die ist im Volk absolut diskreditiert, vor allem wegen der Korruption. Untersuchungen sagen, dass die ärmeren Haushalte mehr als dreißig Prozent ihres Einkommens für Schmiergelder und Bestechungen zahlen müssen!
Haben Sie selber Erfahrungen mit Korruption gemacht?
Nein, ich nicht direkt. Bei uns Hilfsorganisationen ist man da sicher vorsichtiger. Aber ich höre von Leuten, dass sie bei der Schulanmeldung, bei der Verlängerung des Führerscheins oder ähnlichen amtlichen Dingen bezahlen müssen, damit es schneller geht oder überhaupt funktioniert. Das ist alles wahnsinnig zäh und macht die Leute sehr müde.
Am Wochenende wählen die Afghanen ein neues Parlament. Die Taliban haben angekündigt, Wähler und Wahlhelfer zu bombardieren. Haben Sie Angst vor der Wahl?
Ich persönlich habe keine Angst. Es ist einfach klar, dass das einer der Tage ist, an denen wir uns draußen nicht bewegen. Aber natürlich birgt es für die Leute, die wählen gehen, ein Risiko und einige wird das mit Sicherheit auch vom Wählen abhalten. Trotzdem werden viele zu den Wahllokalen gehen, weil sie ihre Stimme abgeben wollen.
Haben Sie, wenn Sie in den Bergregionen unterwegs sind und mit der einfachen Bevölkerung sprechen, das Gefühl, dass die Demokratie dort eine Rolle spielt?
Was ich selbst in den abgelegenen Bergregionen wahrnehme, ist ein erhitztes Klima im Vorfeld der Wahlen. Die Menschen wissen, dass gewählt wird, dass es um Macht und Vertretung geht. Die Kampagnen laufen auch in den letzten Winkeln. Wer gebildet ist, wird dies auch mit Demokratie in Verbindung bringen, aber das ist ein sehr abstraktes Wort. In den Gebieten, in denen wir arbeiten, gibt es keine staatliche Präsenz. Dort herrschen Warlords, die die Macht an sich gerissen haben und das Machtvakuum ausfüllen.
Wie ist die humanitäre Situation inzwischen in Afghanistan?
Die Lage ist katastrophal. Besonders die Kinder- und Müttersterblichkeit ist ohnehin enorm hoch. Im Hazarajat, wo wir arbeiten, kommt das Problem hinzu, dass jetzt der Winter kommt, der sehr hart ist. Die Menschen haben nicht ausreichend zu essen, weil die Ernte durch Überschwemmungen gering war. Auch die Gesundheitsversorgung ist schlecht. Dort versuchen wir zu helfen. Leider gibt es viele Gebiete, zu denen Hilfsorganisationen keinen oder nur sehr schwer Zugang haben.
Werden Sie wütend, wenn Sie das Leid der Bevölkerung sehen?
Ich habe neulich in der Schweiz eine Fotoausstellung über Afghanistan besucht. Da waren Bilder von Kindern aus den sechziger Jahren. Und da habe ich gedacht: Was haben die für ein Leben gehabt? Die haben zwanzig, dreißig Jahre Krieg erlebt. Das geht mir nahe.
War es aus Ihrer Sicht richtig, dass man vor knapp zehn Jahren in Afghanistan einmarschiert ist?
Ja, auf jeden Fall. Es war richtig, dort militärisch zu intervenieren. Aber die Art und Weise, wie dieser Krieg geführt wurde, war falsch. Die Amerikaner sind hier einmarschiert, um Al-Kaida zu jagen und hatten überhaupt keine langfristige Perspektive.
Und wenn die Truppen bald abziehen?
Dann wäre das eine Katastrophe. Ich weiß zwar nicht, was passieren würde, aber es wäre eine Kapitulation. Und man müsste sich auch die Frage stellen, warum man überhaupt zehn Jahre hier war.
Gibt es etwas, das Ihnen Hoffnung macht?
Es wächst jetzt eine Generation heran, die in die Schule geht und die ein normales Leben führen will. Es wird zwar noch sehr lange dauern, bis das Land hier stabilisiert ist, aber ich bin zuversichtlich, dass es nicht mehr so finster wird wie in den 90er Jahren.
Mit Marianne Huber sprach Leonard Goebel
Quelle: ntv.de