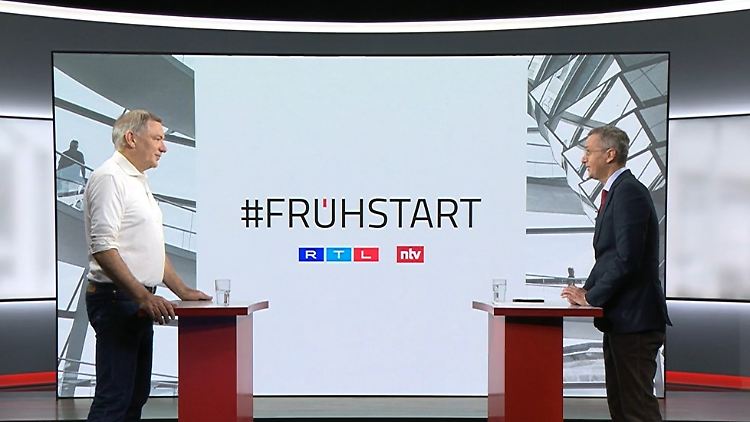Bericht über US-Anti-Drogenbehörde DEA wird zum Nachrichtendienst
26.12.2010, 16:10 UhrDie US-amerikanische Anti-Drogenbehörde DEA entwickelt sich immer mehr zu einem weltweit tätigen Geheimdienst. Das geht aus US-Botschaftsdepeschen hervor, die auf Wikileaks veröffentlicht werden. Die Behörde sei längst über den Kampf gegen Rauschgift hinaus im Einsatz. Sie führe in aller Welt Aktionen auf anderen Kriminalitätsfeldern durch. Sie ist wie das FBI dem Justizministerium unterstellt.

Auch an der Festnahme des kolumbianischen Drogenbosses Munera, genannt der Zwilling, hatte die DEA wesentlichen Anteil.
(Foto: picture-alliance/ dpa)
Die US-Anti-Drogenbehörde DEA ist nach einem Pressebericht zu einer global agierenden Organisation mutiert, deren Arbeit immer mehr traditionellen Nachrichtendiensten ähnelt. Das Betätigungsfeld der DEA gehe heute weit über das Vorgehen gegen den internationalen Drogenhandel hinaus, berichtete die "New York Times" unter Berufung auf Depeschen aus US-Botschaften, die von der Enthüllungswebsite Wikileaks veröffentlicht wurden. Die Kompetenzen der Behörde seien inzwischen so umfangreich, dass sich die DEA sogar mit Forderungen ausländischer Regierungen konfrontiert sehe, sie beim Vorgehen gegen politische Gegner zu unterstützen.
So habe Panamas Staatschef Ricardo Martinelli im August 2009 dem US-Botschafter eine dringende Nachricht über sein Mobiltelefon geschickt, berichtete die Zeitung unter Berufung auf ein Botschaftstelegramm. "Ich brauche Hilfe, um Telefone anzuzapfen", habe der Staatschef geschrieben und die DEA um Unterstützung beim Vorgehen gegen seine politischen Rivalen gebeten. Eine ähnliche Forderung sei Anfang des Jahres von Paraguays Regierung gekommen, berichtete die "New York Times". Ziel der Abhöraktion sollten Mitglieder der bewaffneten Guerilla-Organisation Paraguayische Volksarmee (EPP) sein. In beiden Fällen wurde die Unterstützung der Zeitung zufolge abgelehnt.
In Mexiko wiederum hält das Militär offenbar größere Stücke auf die DEA als auf die eigene Polizei. Nach einem Botschaftstelegramm vom Oktober 2009 baten Armeevertreter in privaten Gesprächen die Drogenbehörde um eine engere Zusammenarbeit, weil sie der mexikanischen Polizei nicht trauten.
Partnerschaften mit problematischen Regierungen
Die "New York Times" betonte, große Enthüllungen enthielten die Depeschen zu den DEA-Aktivitäten nicht. Sie zeigten aber, dass sich die DEA durch die internationalen Verflechtungen des Drogenhandels längst aus dem Schatten der Bundespolizei FBI gelöst habe und über den Drogenhandel hinaus Informationen aus dem Ausland liefere. Demnach berichteten etwa DEA-Informanten in Birma nicht nur, wie sich die dortige Militärregierung mit Drogengeldern bereichert, sondern auch wie sie gegen die Opposition vorgeht. Mit inzwischen 87 Büros in 63 Ländern unterhalte die DEA auch enge Partnerschaften mit Regierungen, die den US-Auslandsgeheimdienst CIA auf Distanz halten wollten.
Mehrere von der DEA berichtete Episoden beschreiben derweil die enge Verquickung von Politik und Drogenhandel in vielen Ländern, wie es in dem Bericht weiter heißt. In Guinea stellte sich beispielsweise nach einer Depesche vom Mai 2008 heraus, dass der größte Drogenbaron des Landes gleichzeitig der Sohn des damaligen Präsidenten war und beschlagnahmte Drogen vor der Zerstörung durch Mehl ersetzt wurden. Aus Sierra Leone berichtete die DEA laut einer Depesche vom März 2009, dass der Justizminister des Landes 2,5 Millionen Dollar Schmiergeld von Angeklagten in einem Drogenhandelsverfahren gefordert habe.
Die spanische Zeitung "El Pais" berichtete ihrerseits unter Berufung auf Wikileaks-Depeschen, dass Teile Westafrikas inzwischen zu einem zentralen Stützpunkt südamerikanischer Drogenkartelle geworden sind. Der Kampf südamerikanischer Regierungen gegen den Drogenhandel habe die Kartelle gezwungen, sich bei den Schmuggelrouten nach Europa und in die USA nach Umschlagplätzen mit weniger Fahndungsdruck umzusehen, berichtete die Zeitung am Sonntag. Länder wie Guinea-Bissau befänden sich regelrecht "in den Händen krimineller Organisationen".
Quelle: ntv.de, AFP/dpa