Studie zur VerbrechensaufklärungDatenspeicherung hilft kaum
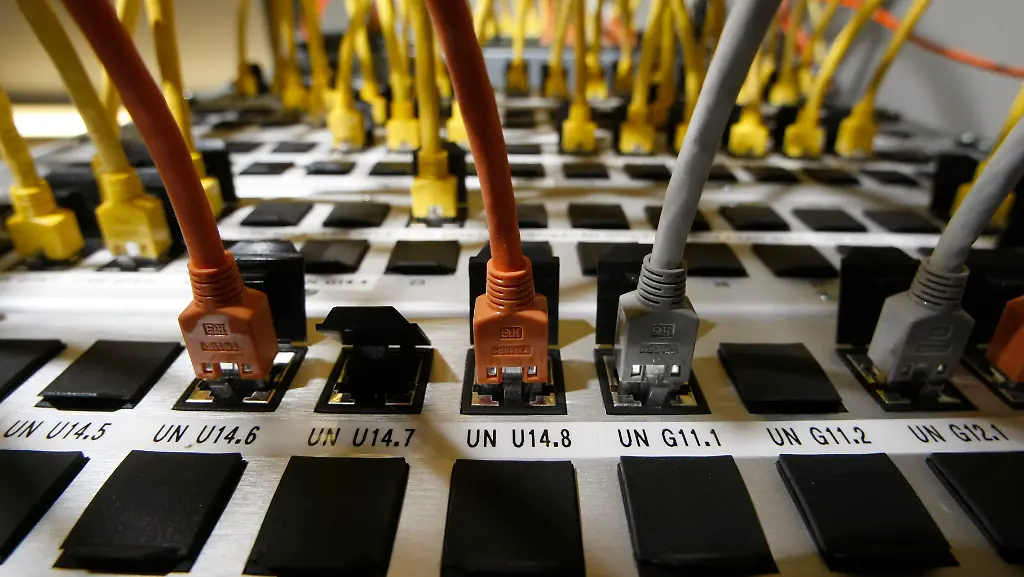
Eine Untersuchung des Max-Planck-Institutes zeigt: Die Vorratsdatenspeicherung trägt nicht bedeutend zur Aufklärung von Verbrechen bei. Deren Notwendigkeit sei "nicht empirisch belegt, sondern nur ein Gefühl der Praktiker ist", erklärt der Parlamentarische Staatssekretär im Bundesjustizministerium, Stadler. Seine Ministerin wird's freuen.
Die hat einer aktuellen Studie zufolge keine essenzielle Bedeutung für die Strafverfolgung. Der Wegfall der Speichermethode nach dem Verfassungsgerichtsurteil von 2010 könne nicht als Grund für Veränderungen bei der Aufklärungsquote von Straftaten herangezogen werden, heißt es in der vom Bundesjustizministerium veröffentlichten Expertise des Max-Planck-Institutes für internationales Strafrecht.
Die Wissenschaftler gingen in ihrer Untersuchung der Frage nach, ob der Wegfall der Vorratsdatenspeicherung nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom März 2010 Auswirkungen auf die Quote aufgeklärter Straftaten hatte. Gegenwärtig könnten die Auswirkungen des Richterspruchs noch nicht mit belastbaren Zahlen quantifiziert werden, betonten die Wissenschaftler des Max-Planck-Instituts. Vielmehr sei die Diskussion über die Vorratsdatenspeicherung durch den Verweis auf Einzelfälle bestimmt, in denen es einen Nutzen für die Strafverfolgung gegeben haben soll.
Dabei werde stets von "typischen" Einzelfällen gesprochen, ohne dass dies empirisch belegt sei, betonten die Wissenschaftler. In der Studie wurden auch Praktiker aus den Strafverfolgungsbehörden befragt, die sich dabei für die Wiedereinführung der Vorratsdatenspeicherung aussprachen.
"Die Studie zeigt, dass die Notwendigkeit der Vorratsdatenspeicherung nicht empirisch belegt, sondern nur ein Gefühl der Praktiker ist", erklärte der Parlamentarische Staatssekretär im Bundesjustizministerium, Max Stadler (FDP). "Die Vorratsdatenspeicherung hat keinen messbaren Einfluss auf Aufklärungsquoten." Eine anlasslose Speicherung lehnt das Ministerium nach wie vor ab.
Knatsch in der Koalition
Die seit Monaten um die Vorratsdatenspeicherung, nachdem die bisherige Regelung von Karlsruhe 2010 gekippt worden war. Seitdem dürfen Telefon- und Internetverbindungsdaten nicht mehr anlasslos sechs Monate lang zur Kriminalitätsbekämpfung gespeichert werden.
Für eine Neuregelung ist Justizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger (FDP) zuständig. Sie will die Daten aber nur nach konkretem Anlass speichern lassen, damit sie Ermittlern bei Bedarf zur Verfügung stehen ("Quick-Freeze-Verfahren"). Der Union und dem CSU-geführten Bundesinnenministerium geht das aber nicht weit genug. Sie fordert dagegen die vorsorgliche Datenspeicherung für sechs Monate.
Deutschland hat eine zur Vorratsdatenspeicherung, die neben der Speicherung von Mobilfunkverkehrsdaten auch die von Internetverkehrsdaten vorsieht, bislang noch nicht umgesetzt.