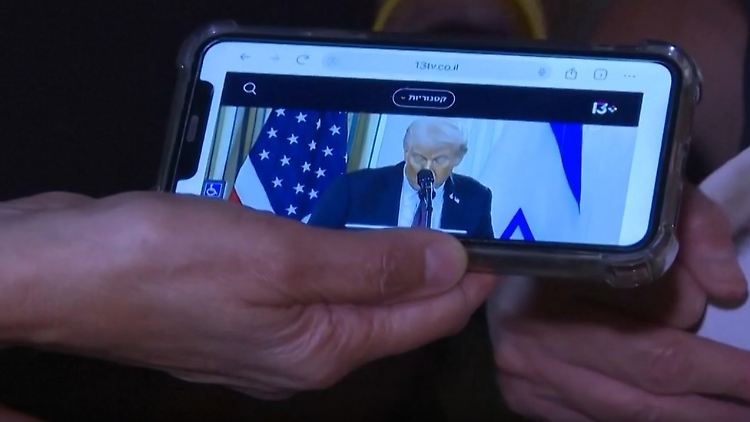"Verbrauchergezielt abschalten" Dena lehnt Reserve-AKW ab
14.07.2011, 10:39 UhrDie Deutsche Energie-Agentur rechnet mit einem weitaus stärkeren Zuwachs an Strom aus erneuerbaren Energien als in den Planungen der Bundesregierung vorgesehen. Das geplante Reserve-AKW lehnt sie als nicht notwendig ab.
Der Chef der Deutschen Energie-Agentur Dena, Stephan Kohler, hat sich dagegen ausgesprochen, ein altes Atomkraftwerk als Reserve für Engpässe im Winter am Netz zu lassen. "Im kommenden Winter könnte es knapp werden, aber nach unseren bisherigen Berechnungen kann die Versorgungssicherheit gewährleistet werden", sagte Kohler. "Es gibt eine Alternative zu einem Reservekraftwerk."
Derzeit prüft die Bundesnetzagentur, ob eines der abgeschalteten AKW als Reserve am Netz bleiben soll. Kohler forderte: "Wir sollten nicht nur auf die Kraftwerke schauen, sondern in bestimmten Situation auch verbrauchergezielt abschalten." So gebe es Möglichkeiten der Industrie für einzelne Abschaltungen - und entsprechende Angebote von Unternehmen. Dafür müsse man etwas bezahlen. "Aber das wäre kostengünstiger, als ein Kernkraftwerk in Reserve zu halten."
Die Annahmen der Bundesregierung, nach denen erneuerbare Stromquellen bis 2020 einen Anteil von rund 35 Prozent ausmachen, stufte Köhler zudem als überholt ein. Die Annahmen auf Bundesebene stimmten nicht mehr mit den Planungen der Länder überein. Mit dem Erneuerbare-Energien-Gesetz werde nicht gesteuert, in welchen Regionen der Ausbau wie schnell voranschreiten solle. Deshalb habe die Dena die Länder nach ihren tatsächlichen Plänen gefragt.
Onshore-Windkraft boomt
Das Ergebnis sei, dass 50.000 Megawatt allein aus Windkraft an Land bis 2020 nicht unrealistisch seien, sagte Kohler. "Das übersteigt, was bundesweit unterstellt wurde." Mehrere Zeitungen hatten bereits berichtet, dass laut Dena schon 2022 bis zu 58 Prozent Ökostrom zu erwarten seien. Nun erläuterte Kohler Details.
"Zum Beispiel Schleswig-Holstein hat die für Windparks freigegebene Fläche von 0,5 Prozent auf 1,5 Prozent erhöht", sagte er. "Deshalb ist zu erwarten, dass allein hier 13.000 Megawatt Onshore-Windkraft gebaut werden. Bisher war man von 3700 Megawatt ausgegangen." Für die Flächen stünden auch Investoren bereit.
"Da alle Länder die Energiewende vorantreiben, würde es laut deren Planungen insgesamt über 60.000 Megawatt Windkraft an Land bis 2020 geben", so der Dena-Vorsitzende. "Wir können nicht sagen, ob die Planungen der Länder komplett Realität werden. Aber eine Verdoppelung des Zubaus auf jährlich 3000 Megawatt ist realistisch." Also könnten bis 2020 rund 25.000 Megawatt zugebaut werden. Im vergangenen Jahr habe der Zuwachs noch 1600 Megawatt betragen.
"Es gibt fast einen olympischen Gedanken"
Um die Steigerungen zu erreichen, müssten Höhenbeschränkungen von Windkraftwerken aufgehoben werden. "Da hören wir, dass Länder und Kommunen dazu bereit sind - nicht flächendeckend, aber auf relevanten Flächen", sagte Kohler. Die Länder gingen in Konkurrenz zueinander. "Es gibt fast einen olympischen Gedanken."
Deshalb forderte der Dena-Chef: "Wir werden einen noch stärkeren Netzausbau benötigen als in unserer Netzstudie II angenommen." In dieser Studie ging die Dena davon aus, dass 3600 Kilometer Höchstspannungstrassen bis zum Jahr 2020 neu gebaut werden müssen. "Sonst werden Windkraftwerke gebaut, und der Strom kann nicht abtransportiert werden", mahnte Kohler.
Quelle: ntv.de, dpa