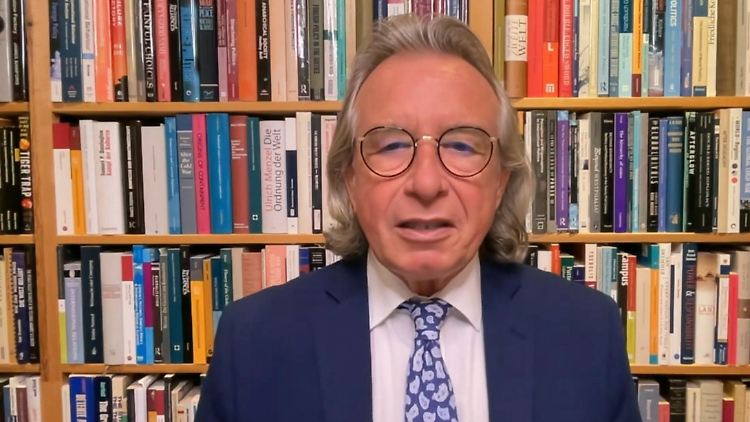Weltweites Bildungsranking Deutschland sackt ab
18.09.2007, 11:50 UhrTrotz leichter Verbesserungen fällt das deutsche Bildungssystem nach dem neuen OECD-Bericht 2007 im internationalen Vergleich weiter zurück. Während die Bundesrepublik in den vergangenen zehn Jahren die Zahl der Studenten um 5 Prozent steigern konnte, legten die 29 anderen wichtigsten Industrienationen im Schnitt um 41 Prozent zu. Unterm Strich schaffen 20 Prozent eines Jahrganges in Deutschland einen akademischen Abschluss - in Dänemark, Finnland oder Polen sind es mehr als 40 Prozent. Deutschland sackt damit nach dem in Berlin vorgelegten Bericht der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung im weltweiten Vergleich vom 10. auf den 22. Rang ab.
Erneut wird in der jährlichen Bildungsanalyse die geringe Abiturienten- und Akademikerzahl in Deutschland kritisiert. Die Bundesrepublik sei nicht in der Lage, alle Arbeitsplätze für die in den nächsten Jahren aus Altersgründen ausscheidenden Ingenieure oder Lehrer mit eigenen Nachwuchskräften zu besetzen - geschweige denn auf den weiteren Trend zur Höherqualifizierung auf dem Arbeitsmarkt zu reagieren.
Drs. allerorten
Dafür liegt Deutschland bei den Promotionen international in der Spitzengruppe. Fasst man die Absolventen weiterführender Forschungsprogramme, also vor allem Promotionen, ins Auge, liegt Deutschland mit 2,4 Prozent auf dem dritten Platz hinter der Schweiz (3,1 Prozent) und Portugal (2,6 Prozent). Der Wert in Deutschland ist fast doppelt so hoch wie im OECD-Durchschnitt (1,3 Prozent). 13,4 Prozent der Promotionen in Deutschland entfallen auf ausländische Studierende. Generell erfreuen sich deutsche Hochschulen international großer Beliebtheit: Deutschland liegt an dritter Stelle der beliebtesten OECD-Gastländer, nach den USA und Großbritannien.
Zu frühe Selektion
OECD-Generalsekretär Angel Gurra kritisierte die in Deutschland übliche Aufteilung von zehnjährigen Kindern auf unterschiedliche Schulformen. Oberschichtkinder hätten eine mehr als doppelt so große Studienchance wie Schüler aus einfachen Familien. Nur 21 Prozent aller 15-Jährigen in Deutschland können sich überhaupt perspektivisch ein Studium vorstellen. Im OECD-Schnitt sind es 57 Prozent.
"Dem Bildungssystem in Deutschland ist es bislang noch nicht gelungen, den völlig neuen Anforderungen gerecht zu werden", kritisierte der OECD-Bildungsexperte Andreas Schleicher bei n-tv. "Nicht nur im Bereich der Ingenieure und Pädagogen, sondern auch in anderen Bereichen" würden der Mangel an Spitzenkräften und die damit verbundenen Probleme sichtbar.
Den OECD- Indikatoren zufolge kann das deutsche, öffentlich finanzierte Hochschulsystem die gewünschte Chancengerechtigkeit beim Hochschulzugang nicht realisieren, so Schleicher. "Die Bildungserwartungen junger Menschen in Deutschland sind oft von Anfang an sehr niedrig gesetzt." Dieses Problem lasse sich auch durch Zuwanderung von Fachkräften nicht beheben.
Politiker räumen Versäumnisse ein
Bundesbildungsministerin Annette Schavan (CDU) kündigte einen "Bildungs-Herbst" an. Bund und Länder müssten "umgehend" über Strategien nachdenken, um diese Schwierigkeiten zu meistern. In der Tat sei es notwendig, mehr junge Leute an die Hochschulen zu bringen und zugleich die Zahl der Abbrecher deutlich zu reduzieren. Ein erster Schritt sei die neue Struktur mit Bachelor- und Master- Abschlüssen. Schavan plädierte zudem dafür, im öffentlichen Dienst mehr Anreize für Lehrer zu schaffen.
Der Präsident der Kultusministerkonferenz (KMK), Berlins Bildungssenator Jürgen Zöllner (SPD), räumte ebenfalls ein, dass zu wenige junge Menschen an die Hochschulen herangeführt würden. Dabei müssten auch zwischen dem betrieblichen Ausbildungs- und dem Hochschulsystem "Türen" aufgemacht werden für spezielle Studiengängen. Es spreche nichts dagegen, jungen Leuten nach einer Berufsausbildung einen Hochschulzugang zu ermöglichen. Allerdings müsste dieser dann fachspezifisch sein, argumentierte Zöllner. Schavan plädierte dafür, bestimmte Bereiche zu definieren, in denen diese Durchlässigkeit beider Systeme möglich erscheint.
Zunehmende Ungleichheit
Andreas Schleicher verwies bei n-tv insbesondere auf die Konsequenzen, die ungleicher Zugang zu Bildung und Arbeit gesamtgesellschaftlich mit sich bringen. "Die Chancen derjenigen, die gut gebildet sind, waren nie so gut wie heute. Der Einkommensvorteil einer Universitätsausbildung ist allein in den letzten zehn Jahren um 26 Prozentpunkte gewachsen, während diejenigen am anderen Ende immer weiter herausfallen." Zwar habe Deutschland in den Bereichen Vorschule und Schule bereits guten Willen gezeigt, räumt der OECD-Experte ein. "Klar ist aber, dass die Reformdynamik weiterhin in vielen Ländern der OECD deutlich stärker ausgeprägt bleibt."
Quelle: ntv.de