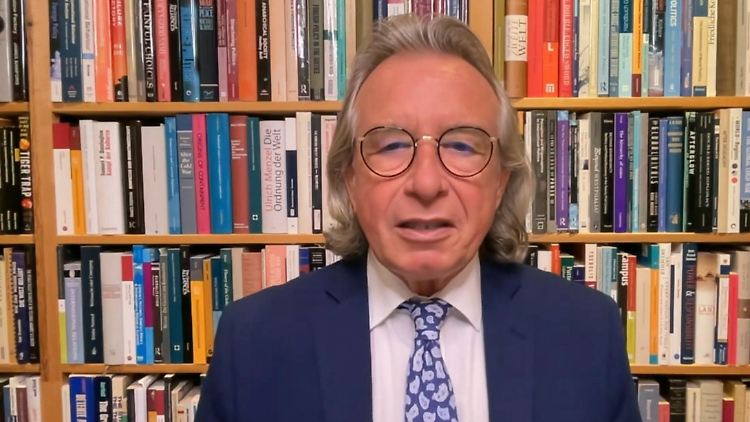Mosambiks "Erfolgsgeschichte" Die Armut aber bleibt
16.11.2010, 13:39 UhrMosambiks "Erfolgsgeschichte" ist typisch für Afrika: Statistiken spiegeln seit Jahren einen Wirtschaftsboom wider - aber das Leben der bitterarmen Bevölkerung verändert das kaum. Hungerunruhen wie im September drohen bald wieder.

Bei den Hungerunruhen im September kommen 13 Menschen ums Leben, Hunderte werden verletzt.
(Foto: REUTERS)
Schuhputzer haben es schwer, wenn die meisten Passanten nur Latschen tragen. Aber Dinis Langa (50) hat zumindest einen Job - im Unterschied zu Millionen seiner Landsleute im bettelarmen Mosambik. Aber der Schuhputzer ist bedrückt: "Die Preise steigen, es ist immer schwerer, zu überleben", klagt der Vater von acht Kindern. Er leidet darunter, dass Lebensmittel immer teurer werden. Von der befremdlichen Abhängigkeit seines fruchtbaren Heimatlandes von Gemüse- und Obstimporten weiß er nichts.
Langas winziger Stand im Herzen der Hauptstadt Maputo bringt etwa 2500 Meticel im Monat, umgerechnet 50 Euro. Hätten seine zwei ältesten Kinder keine Jobs, wüsste er nicht, wie er die Familie ernähren sollte. Er sei bei den Hungerunruhen im September, als 13 Menschen starben und Hunderte verletzt wurden, nicht dabei gewesen, betont Langa. Aber Verständnis für die Nöte und den Zorn der Menschen hat er schon.
Wird alles bald besser?
Der Schuhputzer, dessen Arbeitswerkzeuge gerade mal ein Hocker, einige alte Bürsten und Poliertücher sowie drei Dosen Schuhcreme sind, hofft, dass sich die Zeiten ändern. Alles werde bald besser - so wie es die "Frelimo"-Regierung schon lange verspricht. An der Macht sind die Ex-Freiheitskämpfer schon seit 1975. Dabei hat sich schon viel geändert in dem einst sozialistischen Land, das in den 90ern der Staatswirtschaft abschwor und sich dem Markt öffnete.
Experten von Weltbank und Internationalem Währungsfonds (IWF) schwärmen von der "Erfolgsgeschichte" Mosambik. Aber der ostafrikanische Staat scheint eher typisch für die Fragwürdigkeit des oft beschworenen afrikanischen Aufbruchs. Etwa acht Prozent Wirtschaftswachstum im Jahresdurchschnitt konnte Mosambik seit 1994 verzeichnen. Doch der Boom des dünn besiedelten Landes mit seinen enormen Rohstoffreserven (Kohle, Bauxit, Gold, Titan) spiegelt sich kaum im Leben der 20 Millionen Menschen wider.

Guebuza bei den Feierlichkeiten zur 35-jährigen Unabhängigkeit Mosambiks.
(Foto: Reuters)
Wie in so vielen Ländern Afrikas profitieren von dem sprudelnden Geldsegen wachsender Rohstoff-Exporte nur eine schmale einheimische Elite sowie internationale Konzerne. Mosambik gehört mit einem jährlichen Pro-Kopf-Einkommen von etwa 400 US-Dollar zu den ärmsten Ländern der Welt. Im UN-Ranking der Entwicklung steht Mosambik auf Platz 172 von 182 Ländern. Und der jüngste Armutsbericht der Regierung zeigt, dass sich der Anteil der Armen von 54 Prozent an der Gesamtbevölkerung seit 2003 kaum geändert hat.
Dabei weckten Milliarden-Investitionen im Bergbau und Energiesektor so viele Hoffnungen. Aber entstanden sind nur einige zehntausend Arbeitsplätze. Ausländische Konsortien planen am Sambesi neue, riesige Staudämme - aber angesichts des Mangels an qualifizierten einheimischen Kräften werden oft selbst die Facharbeiter für den Bau eingeflogen. "Es geht der Regierung nur darum, Megaprojekte an Land zu ziehen, die Weltbank und IWF zu beeindrucken", kritisiert der Sozialwissenschaftler Rogério Ossemane vom unabhängigen Politikinstitut IESE (Maputo).
Investitionen sind dringend nötig
Mosambik ist für Investoren hochinteressant - zwar braucht es laut Auskunft von Experten meist "Beziehungen zur Regierung" und oft auch das Gleitmittel der Bestechung; aber läuft ein Projekt erst mal, fallen nur noch wenige Steuern ab, Gewinne können weitgehend exportiert werden.
Mosambik braucht dringend Investitionen, aber es muss nicht nur Maschinen, sondern auch Getreide, Obst und Gemüse importieren. Es fehlen Straßen und ein Vertriebssystem, um Agrarprodukte in die Städte zu bringen. Zudem wurde ausgerechnet im bitterarmen Mosambik Ausbau und Förderung der Landwirtschaft jahrelang vernachlässigt - 88 Prozent der nutzbaren Fläche liegen brach. "Auch Geberländer und Weltbank müssen sich fragen, welche Mitschuld sie an dieser Fehlentwicklung haben", gestand ein europäischer Diplomat.
Die Geberländer (G19), die die Hälfte des Staatsetats finanzieren, sahen in Mosambik lange ein Musterland. Es stand für Frieden und Aussöhnung nach langem Bürgerkrieg, imponierte mit hohen Wachstumsraten. Längst ist Ernüchterung eingekehrt. Denn auch das demokratische Mosambik erinnert an frühere Ostblockländer. Ohne die Staatspartei Frelimo geht hier gar nichts. Sie hat Gewerkschaften, Medien und Institutionen fest im Griff. Die "G19" fordern inzwischen von Präsident Armando Guebuza die Trennung von Staat und Partei, Kampf gegen Korruption und Abbau des Staatsdefizits.
"Mosambik ist in Gefahr"
Also kürzte die Regierung Subventionen von Brot und Benzin - Auslöser der jüngsten Unruhen. Demonstranten legten Maputo lahm, zündeten Reifen und Tankstellen an, lieferten sich Straßenschlachten mit überforderten Polizisten. Aber die Reaktion der Straße zwang Guebuza zum demütigenden Rückzug, die Preiserhöhungen wurden zurückgenommen. Alle in Maputo wissen, dass bald neuer Protest droht. Denn die Subventionen sollen endgültig gestrichen werden. "In Mosambik ist es wie in vielen Staaten Afrikas. Die Elite hat kaum Interesse am Wohlergehen des Volkes", meinte ein hoher Repräsentant einer internationalen Organisation. "Auch Mosambik ist heute in Gefahr, zu einem gescheiterten Staat zu werden", fürchtet Ossemane.
Quelle: ntv.de