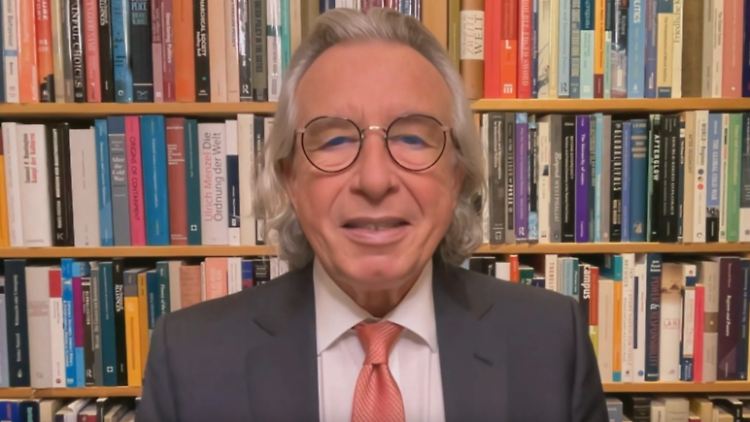Das Rückgrat der US-Kultur Die Welt der Mäzene
19.05.2008, 10:04 UhrDie US-Amerikaner sind ausgesprochen spendabel. Allein der demokratische Präsidentschaftsbewerber Barack Obama konnte für den Kampf ums Weiße Haus seit Anfang 2007 mehr als 240 Millionen Dollar (155 Millionen Euro) Spenden sammeln. Und auch wenn seine Konkurrentin Hillary Clinton inzwischen klamm ist - bei ihr waren es immerhin noch gute 170 Millionen. Von der Großzügigkeit der US-Bürger profitieren aber nicht nur Politiker sondern alle Bereiche des öffentlichen Lebens. "Ungefähr 65 Prozent der Haushalte mit einem Jahreseinkommen unter 100.000 Dollar spenden", sagt der Vorsitzende des Giving Institute in Glenview (Illinois), George Ruotolo. "Das sind mehr, als zum Wählen gehen oder eine Sonntagszeitung lesen."
Finanzspritzen aus privaten Taschen
Vor allem Kunst und Kultur könnten ohne die Finanzspritzen aus privaten Kassen nicht überleben, und hier spielen auch zahlreiche große Mäzene eine gewichtige Rolle. Jüngstes Beispiel: Der milliardenschwere Blackstone-Chef Stephen Schwarzman, "König der Wall Street", ließ der berühmten New York Public Library für ihren dringend benötigten Ausbau gerade einen Rekordzuschuss von 100 Millionen Dollar zukommen. Dafür soll das von Steinlöwen bewachte altehrwürdige Gebäude an der Fifth Avenue nach dem mächtigen Finanzinvestor benannt werden - ein umstrittener Plan. "Ohne die Mäzene wären wir nicht eine der großen Bibliotheken der Menschheitsgeschichte", verteidigt Library-Präsident Paul LeClerc das Vorhaben.
Insgesamt gingen von den 295 Milliarden Dollar, die Amerikaner im Jahr 2006 spendeten (die Zahlen für 2007 liegen noch nicht vor), 12,5 Milliarden in den kulturellen Bereich, Tendenz steigend. Zum Vergleich: Das staatlich finanzierte Förderprogramm "National Endowment for the Arts" ist in diesem Jahr nach hartem Kampf gerade mal auf 145 Millionen Dollar aufgestockt worden. Dreiviertel aller Spenden kommen von Privatleuten, nur ein Viertel von Firmen und Stiftungen. Der Löwenanteil der Zuwendungen geht an kirchliche, soziale und wissenschaftliche Organisationen.
Im "Land der unbegrenzten Möglichkeiten" gilt es fast als selbstverständlich, sich für die Gemeinschaft zu engagieren. Besonders wer Erfolg hat, fühlt sich verpflichtet, auch etwas davon zurückzugeben. Selbst im kleinsten Stadttheater hängt noch eine Bronzetafel mit den Namen der spendablen Honoratioren. Und seit fast 40 Jahren schafft es der landesweite Senderverbund National Public Radio (NPR), statt mit Zwangsgebühren vor allem mit Spenden und Sponsoren ein hervorragendes Programm zu machen. 2005 galt NPR nach einer Umfrage als verlässlichste Nachrichtenquelle der USA.
Mega-Spenden der Superreichen
Für das größte Aufsehen sorgen naturgemäß die Mega-Spenden der Superreichen. Der New Yorker Familienpatriarch David Rockefeller, dessen Vater mit der Rockefeller Foundation bereits eine der größten und einflussreichsten Sozialstiftungen gegründet hatte, vermachte kürzlich medienwirksam der Harvard-Universität 100 Millionen Dollar zur Kunstförderung. Auch privat ein Liebhaber erlesener Malerei, hatte er in den Jahren zuvor dem Museum of Modern Art (MoMA) und der Rockefeller-Universität ebenfalls Spenden in dieser Größenordnung zukommen lassen. "Ich werde nicht ewig leben", witzelte der 92-Jährige kürzlich, "aber ich hoffe, schon noch eine Weile da zu sein, um die Auswirkungen zu genießen."
Auch der Kosmetikerbe Ronald Lauder (geschätztes Vermögen drei Milliarden Dollar) lässt die Allgemeinheit an seiner Leidenschaft für die Kunst teilhaben. Der frühere US-Botschafter in Wien und jetzige Präsident des Jüdischen Weltkongresses (WJC) eröffnete 2001 in Manhattan die Neue Galerie, für die er eine der größten Sammlungen deutscher und österreichischer Kunst des frühen 20. Jahrhunderts zusammengetragen hat - darunter auch die sogenannte "Goldene Adele" von Gustav Klimt, beim Kauf im Juni 2006 mit 135 Millionen Dollar das damals teuerste Bild der Welt.
Nicht immer eitel Sonnenschein
Nicht immer freilich ist das Mäzenatentum eitel Sonnenschein. Das J. Paul Getty-Museum in Malibu bei Los Angeles, der vielleicht reichste Kunsttempel der Welt, war seit seiner Einrichtung 1974 immer wieder umstritten. Lange überschattete eine bittere Familienfehde um das Erbe des eigenwilligen Gründers den Ruf der Institution. Später sorgte ein Tauziehen mit Italien um illegal erworbene Kunstschätze für Aufsehen.
Engagierte Bürger haben sich inzwischen zur Gruppe "Amercians for the Arts" und einem regelmäßigen Gesprächskreis zusammengeschlossen, um den Rückhalt für kulturelle Anliegen dauerhaft zu stärken. Einer der Wortführer ist Oscar-Preisträger Robert Redford, der mit seinem Sundance-Festival seit Jahren den von Hollywood unabhängigen Film fördert. "Kunst ist entscheidend für unsere Gesellschaft", sagt er. "Jeder Amerikaner sollte die Chance haben, an allen Arten der Kunst teilzuhaben." Er hofft, damit beim künftigen Präsidenten mehr Gehör zu finden.
Von Nada Weigelt, dpa
Quelle: ntv.de