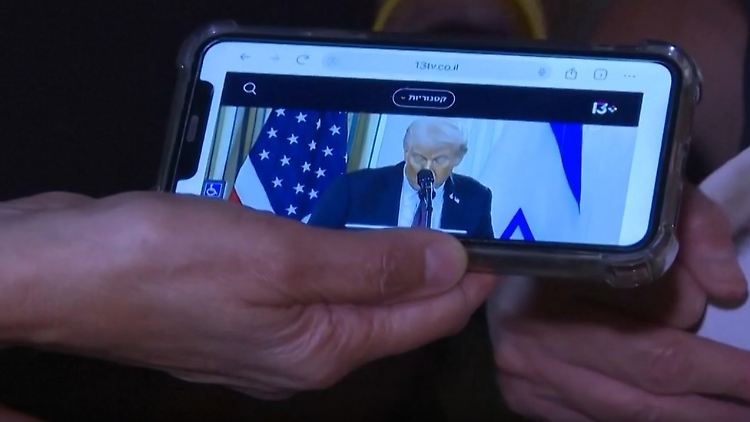"Ergenekon"-Verfahren geht zu Ende Erdogan erlegt die Wölfe
05.08.2013, 08:45 Uhr
Erdogan und das Militär: Eine innige Freundschaft sieht anders aus.
(Foto: REUTERS)
In der Türkei endet ein aufsehenerregender Prozess: Rund 300 Angeklagte stehen unter Putschverdacht. Zu ihnen zählen etliche ehemalige Offiziere und Generäle. Dass diese Eliten überhaupt vor Gericht stehen, manifestiert einen beispiellosen Machtverlust der türkischen Armee.
Verborgen in den Bergen Anatoliens lag einst ein fruchtbares Tal. Es hieß "Ergenekon". Die letzten Überlebenden der türkischen Stämme fanden hier Zuflucht, nachdem die Chinesen ihre Armeen im Krieg besiegt hatten. Den einzigen Zugang zu diesem Tal versperrten sie, um niemals wieder in Kontakt mit der Außenwelt treten zu müssen. Doch Generationen vergingen, aus den wenigen Überlebenden reifte ein starkes Volk heran und die Männer und Frauen drängte es wieder nach draußen. Als sie sich auf ihrem Weg aus den Bergen Anatoliens verirrten, erschien ihnen eine Wölfin. Und das graue Muttertier wies ihnen den Weg zurück in die Welt.
Das verborgene Tal, der graue Wolf, ein erstarkendes Volk - das sind die Kernelemente des Ursprungsmythos der Türken, der "Ergenekon"-Saga. Und es ist kein Zufall, dass der aufsehenerregendste Prozess in der Geschichte des Landes ausgerechnet diesen Namen trägt.
Im Mittelpunkt des Gerichtsverfahrens steht ein angeblich gewaltiges nationalistisches Netzwerk, das den Namen jenes Tals in Anatolien trägt. Es hat geplant, so die Anklage, die Regierung von Ministerpräsident Recep Tayyip Erdogan zu stürzen. Aufmerksam auf "Ergenekon" wurden die Ermittler 2007. Nach einem anonymen Hinweis entdeckte die Polizei im Istanbuler Stadteil Ümraniye ein Sprengstoffdepot. Darin lag neben Handgranaten und TNT-Stangen eine Reihe von Dokumenten. Darin kam nicht nur der Name "Ergenekon" vor. Der Staatsanwaltschaft zufolge ließen die Papiere zusammen mit anderen Dokumenten, die im Zuge der Ermittlungen auftauchten, auch Rückschlüsse auf die Strategie des Geheimbundes zu: Anschläge sollten Unruhe stiften in der Türkei und eine Stimmung schaffen, in der das Militär die Macht übernehmen kann.
Kaum ein Jahr nach dem Fund in Istanbul begann der "Ergenekon"-Prozess. Fast 300 Angeklagte standen vor der Richterbank, darunter etliche hochrangige Militärs, oppositionelle Journalisten, Alt-Kemalisten und andere Regierungskritiker - angeblich die Mitglieder jenes allumfassenden Geheimbundes.
Nach 600 Verhandlungstagen fällt die Justiz nun ihr Urteil. Wie auch immer es ausgehen mag: Schon der Prozess allein hat die Türkei verändert. Er hat das Land zu einem demokratischeren Staat gemacht - obwohl das große Netzwerk Namens "Ergenekon" Türkei-Kennern zufolge überhaupt nicht existiert.
Der Tiefe Staat
Was hat es auf sich mit "Ergenekon"? Schon in den 1970er Jahren machte in der Türkei vermehrt der Ausdruck "Derin Devlet" die Runde, der "Tiefe Staat" oder der "Staat im Staate". Gemeint ist eine geheime Elite, die in Wirklichkeit über die Geschicke des Landes entscheidet. Und eine Reihe von Ereignissen in der türkischen Geschichte lieferte nicht nur Verschwörungstheoretikern Stoff, um über die Existenz dieser Struktur zu spekulieren.
Seit der Gründung der Türkischen Republik im Jahre 1923 putschte das Militär nicht weniger als vier Mal Regierungen von der Macht. Verfechter der Theorie des "Tiefen Staates" behaupten: Möglich war das nur, weil sich das Militär auf Verbündete im Geheimdienst, in der Justiz und Verwaltung, aus terroristischen Organisationen und der organisierten Kriminalität verlassen konnte. Durch konspirative Aktionen dieser Akteure - Anschläge, politische Attentate und Erpressungen - konnte die gesellschaftliche Stimmung entstehen, die die Regierungsstürze ermöglichten.
Beweise dafür, dass es das Netzwerk in dieser Form tatsächlich gibt, konnte allerdings nie jemand liefern. Und so ist es auch beim "Ergenekon"-Prozess, der sich nun dem Ende neigt. Die Anklageschrift umfasst mehrere tausend Seiten, ist für Außenstehende kaum noch nachzuvollziehen. Eine Reihe von Prozessbeobachtern berichtet von Ungereimtheiten, illegal erworbener Dokumente und Mutmaßungen, die ohne weitere Erläuterung unkritisch neben Tatsachen stehen. Einige Kritiker sprechen gar von einem Schauprozess. Doch so weit muss man gar nicht gehen.
Das Netzwerk ist vermutlich eine Konstruktion
Nach Angaben des Türkei-Experten der Stiftung Wissenschaft und Politik, Günter Seufert, gab es jene Putschpläne, um die es sich in dem Prozess dreht. "Das ist eine Tatsache", sagt Seufert n-tv.de. Auch von politisch motivierten Morden weiß er zu berichten. Doch damit hört es auf. An die Existenz eines Masterplans von einem Staat im Staate, an dem neben dem Militär auch Vertreter anderer Institutionen teilhaben, glaubt er nicht. Er spricht vielmehr von einer Reihe von illegalen Aktionen verschiedener Akteure, die nicht unmittelbar zusammenhängen.
"Dass das ein großer Wurf war, da habe ich meine Zweifel", sagt er. Die Staatsanwälte, die der Regierung nahe stehen, hätten die Existenz dieser Struktur vielmehr behauptet und verurteilten sie nun als terroristische Vereinigung. Und das fällt auch dank des Verweises auf die "Ergenekon"-Saga nicht einmal schwer. Schließlich verbindet all die Angeklagten eine gewisse Ideologie. Sie sehen sich als Bewahrer des Vermächtnisses des Staatsgründers Mustafa Kemal Atatürk. Der Offizier, der sich bis heute größter Beliebtheit in der türkischen Gesellschaft erfreut, setzte auf Demokratie und Säkularismus. Er prägte aber auch die Ideologie des Türkentums. Was praktisch alle Angeklagte eint, ist ihr Nationalismus. Und die "Ergenekon"-Saga ist das nationalistische Symbol schlechthin. Fast jede nationalistische Bewegung in der Türkei beruft sich auf diesen Ursprungsmythos. Die rechtsextreme Bewegung der "Grauen Wölfe" ist ein Beispiel. Zudem kennt jeder Türke die Geschichte vom verborgenen Tal in Anatolien und dem erstarkenden Volk, das aus ihm hervorging. "Ergenekon", jener Mythos ist zumindest symbolisch das Bindeglied zwischen all den Akteuren, die angeblich gemeinsam am großen Sturz gearbeitet haben.
Für die Regierung Erdogan hat diese Konstruktion vor allem einen praktischen Zweck. "Es ist eine Möglichkeit, einzelne kriminelle Handlungen, direkt den hohen Spitzen der Militärführung anzulasten", sagt Türkei-Experte Seufert. Laut Seufert geht es bei dem Prozess in erster Linie darum, das Militär, das stets eine gewaltige politische Kraft in der Türkei war, zu entmachten. Und dieser Plan ging auf, das zeichnet sich schon vor dem Urteilsspruch der Richter deutlich ab.
Das Militär hat seine Macht schon verloren
Es war vielmehr Erdogan, dem es gelungen ist, Netzwerke in allen bedeutsamen Institutionen zu verankern. Nach seinem Amtsantritt 2002 verstand er es, konservative Kreise und politisierte Muslime in Justiz, Verwaltung und Polizei zu installieren. Zugleich wusste er, zumindest zu Beginn seiner Amtszeit auch liberale Kräften in der Gesellschaft zu binden. Die, die es Leid waren, alle zehn Jahre einen Militärputsch zu erleben. So schuf er die Voraussetzung um die Macht des Militärs zu brechen.
Schon im vergangenen Jahr fiel ein erstes Urteil gegen die Spitzen des Militärs. Anlass war ein Planspiel der Streitkräfte namens "Balyoz" (Vorschlaghammer). Es ist das Szenario eines Sturzes der Regierungspartei AKP. Die Justiz brummte etlichen hochrangigen Ex-Generälen jahrzehntelange Haftstrafen auf, darunter der frühere Marinekommandeur Özden Örnek, General a.D. Cetin Dogan und Ex-Luftwaffenchef Ibrahim Firtina.
Und der Machtverlust offenbart sich nicht nur in der Justiz. Bei der alljährlichen Tagung des hohen Militärrats, der über Beförderungen in der Armee entscheidet, setzte das Gremium etliche Angeklagte im "Balyoz"- und "Ergenekon"-Prozess, die noch im Militär aktiv sind, auf die Pensionierungsliste.
Am deutlichsten trat die neue Rolle des Militärs allerdings zu Tage, als sich bei den Protesten rund um den Istanbuler Gezi-Park Zehntausende Türken lautstark gegen den bevormundenden Regierungsstils Erdogans auflehnten. Der Regierungschef schlug mit harscher Polizeigewalt zurück. Seinen Kredit im Ausland büßte er ein und durfte nur noch auf wenig internationalen Rückhalt hoffen. Diese Stimmung in der Gesellschaft wäre die ideale Ausgangslage für einen Militärputsch gewesen. Doch bis heute geschah nichts.
Ein Gewinn für den Demokratieprozess in der Türkei
Erdogan ist gelungen, woran alle seine Vorgänger scheiterten. Er brach die Macht des Militärs. Und wenn die Justiz nun die Angeklagten im "Ergenekon"-Prozess verurteilt, wird er zugleich auch eine Reihe radikaler und gewaltbereiter Regierungsgegner, die nicht aus den Streitkräften stammen, los.
Und sofern unter den Verurteilten keine legitimen Oppositionellen sind, die auf Demokratie und Rechtsstaatlichkeit setzen, ist das trotz der fragwürdigen Umstände des Prozesses ein Gewinn für die türkische Gesellschaft. Davon ist zumindest Seufert von der Stiftung für Wissenschaft und Politik überzeugt. "Es ist auf jeden Fall ein Fortschritt, dass die gewählte Regierung jetzt das Militär kontrolliert und nicht umgekehrt", sagt er. Der Türkei-Experte hält Erdogan deswegen nicht für einen lupenreinen Demokraten. "Er versteht Demokratie ausschließlich als die Herrschaft der Mehrheit und tendiert dazu alle anderen Konnotationen des Begriffs Demokratie, wie Bürgerrechte oder liberale Lebensentwürfe hinten anzustellen", sagt er. Aber es sei ein erster Schritt.
Der nächste Schritt: Jetzt, nach dem Machtverlust des Militärs, das oft im Sinne der breiten Öffentlichkeit gehandelt hat, müssen die Bürger der Türkei schnell demokratische Mittel finden, um Widerstand gegen Verirrungen ihrer Regierung zu finden. Auch das machen die Gezi-Proteste deutlich. Auf ein Eingreifen des Militärs zumindest können sie sich nicht mehr verlassen. Und schon gar nicht auf ein mächtiges Netzwerk Namens "Ergenekon".
Quelle: ntv.de