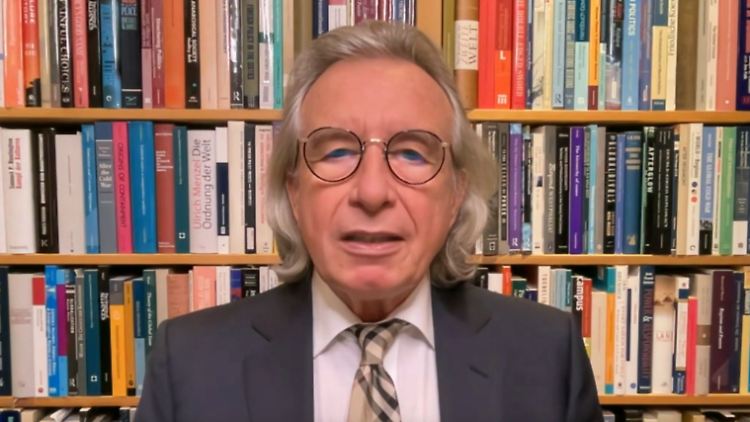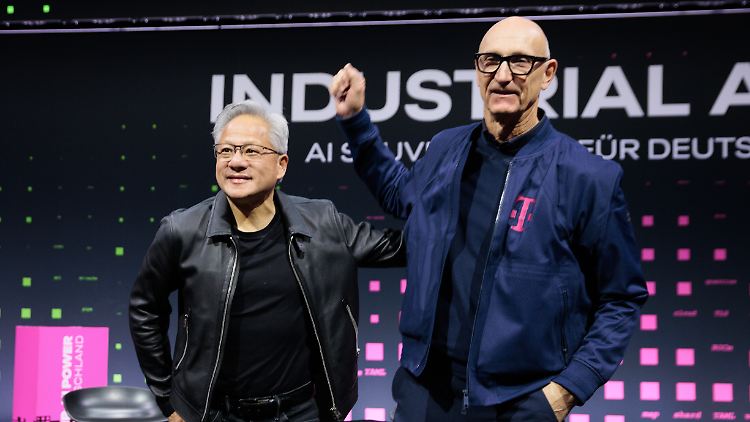"Bürgerarbeit" für 1,3 Mrd Euro Jobwunder vorgestellt
09.07.2010, 17:47 UhrMit dem Programm "Bürgerarbeit" will die Bundesregierung Langzeitarbeitslose in Zukunft intensiver fördern. Die Arbeitslosen sollen Arbeiten ausführen, die dem öffentlichen Interesse dienen. Das Problem der Verdrängung regulärer Arbeitsplätze sollen die Kommunen lösen.

Wer nach sechs Monaten übrigbleibt, soll zur Bürgerarbeit verpflichtet werden, sagt von der Leyen.
(Foto: dpa)
Rund 34.000 Langzeitarbeitslose sollen ab kommendem Januar gemeinnützige "Bürgerarbeit" leisten. "Aktiv zu sein ist besser als zu Hause auf ein Jobangebot zu warten", sagte Arbeitsministerin Ursula von der Leyen (CDU) über ihr Modellprojekt.
Fast die Hälfte aller Jobcenter beteiligt sich an der neuen Förderungsmaßnahme, bundesweit 197. Das dreijährige Projekt wird mit insgesamt rund 1,3 Milliarden Euro gut zur Hälfte vom Bund und zum anderen Teil vom Europäischen Sozialfonds finanziert.
Damit werden die freiwilligen Modellversuche, die bislang nur in einzelnen Regionen in Sachsen-Anhalt stattgefunden hatten, auf alle Länder ausgeweitet. Die Jobcenter wählen ab dem 15. Juli bundesweit zunächst 160.000 Langzeitarbeitslose für eine sechsmonatige "Aktivierungsphase" aus, um sie gezielt in den Arbeitsmarkt zu vermitteln. Erfahrungsgemäß könnten vier von fünf Arbeitslosen auf diese Weise vermittelt werden oder verzichteten freiwillig auf Regelleistungen, sagte von der Leyen. Wer dagegen nach sechs Monaten übrigbleibt, soll zur Bürgerarbeit verpflichtet werden.
900 Euro für 30 Stunden
Sollten Arbeitslose Angebote für "Bürgerarbeit" ablehnen, würden dafür laut Arbeitsministerium im Grundsatz die gleichen Regeln gelten wie für andere Arbeitsangebote. Dies würde auch mögliche Sanktionen einschließen. Für 30 Wochenstunden Arbeit bekommen die Bürgerarbeit ein Monatsgehalt von 900 Euro.
Vorrangig gehe es dabei um Arbeitslose mit geringen Vermittlungschancen in strukturschwachen Regionen mit hoher Arbeitslosigkeit. Die "Bürgerarbeiter" könnten beispielsweise ältere und behinderte Menschen betreuen, Sportangebote für Jugendliche leiten oder Laub aufsammeln, schlug die Ministerin vor. Dabei könnten die Kommunen jedoch selbst entscheiden, welche Arbeiten "ihre" Bürgerarbeiter übernehmen können. Wichtig sei, dass die Arbeit gemeinnützig ist und keine regulären Jobs verdrängt.
Problem der Verdrängung
Kritiker indes verweisen darauf, dass vergleichbare Modellprojekte bisher kaum zur Arbeitsmarktintegration von Arbeitslosen beigetragen haben. Bisweilen ist sogar das Gegenteil der Fall: Weil die Arbeitslosen in einem Förderprogramm eingebunden sind, können sie keine andere Beschäftigung annehmen. Zudem gilt es als heikel sicherzustellen, dass der staatliche soziale Arbeitsmarkt keine regulären Jobs verdrängt.
Die Linke kritisierte, mithilfe der Bürgerarbeit könnte "jeder Erwerbslose erpresst werden, gegen seinen Willen nahezu in Vollzeit, unabhängig von der Qualifikation für seine bloße Existenz zu schuften". Unklar sei auch, ob nicht doch durch die "Bürgerarbeit" bestehende Beschäftigungsverhältnisse verdrängt würden.
Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) kritisierte, vom Konzept Bürgerarbeit stehe bisher "nicht mehr als der schöne Begriff als Fassade". Die Grünen monierten, statt 34.000 Stellen im sozialen Arbeitsmarkt würden 400.000 gebraucht.
Quelle: ntv.de, AFP/rts