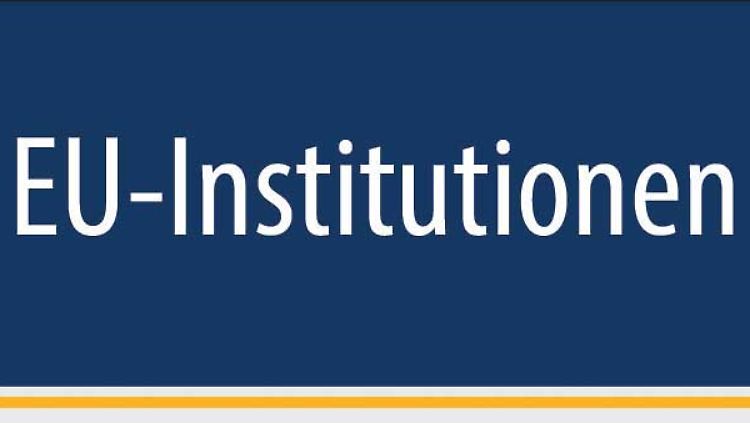So verschieden sind die Kandidaten Junckers Europa, Schulz' Europa
21.05.2014, 06:18 Uhr
Die Unterschiede zwischen Jean-Claude Juncker und Martin Schulz wurden in der ARD-Wahlarena nicht deutlich. Aber es gibt sie.
(Foto: REUTERS)
Die zwei aussichtsreichsten EU-Spitzenkandidaten wollen ein starkes Europa. Doch sie verstehen darunter jeweils etwas völlig anderes.
Martin Schulz streckt seine Hand aus, doch anstatt sie zu greifen, bietet Jean-Claude Juncker lieber ein High Five an. Es ist alles glatt gelaufen, der Auftritt war gut, auch der Handschlag funktioniert noch irgendwie. Juncker und Schulz machen den Eindruck, als wären sie gemeinsam auf Roadshow, um den Wählern die EU zu erklären. Beide reisen durch so viele der 28 EU-Staaten wie möglich, insgesamt treffen sie sich neun Mal in Fernsehsendungen. Dieses Mal stehen sie auf Einladung der ARD in einem Hamburger TV-Studio und lassen sich vom Leuten aus dem Publikum befragen. 21 Fragen bekommen sie gestellt, bis Frage 19 wird nicht eine einzige Meinungsverschiedenheit deutlich. Ist das schon Wahlkampf?
Am 25. Mai wählen die Deutschen ihre Abgeordneten für das Europaparlament. In einigen der 28 Mitgliedstaaten ist der Termin schon etwas früher. Zum ersten Mal gelten bei dieser Wahl die Regeln des Vertrags von Lissabon.
Damit ändert sich vor allem die Besetzung des wichtigsten EU-Postens, nämlich des Kommissionspräsidenten: Bislang wählten ihn die Staats- und Regierungschefs und das Parlament durfte nur zustimmen. Nun wählt das Parlament und die Staats- und Regierungschefs dürfen nur den Vorschlag dafür machen.
Ist das ein unbedeutender Unterschied in der Formulierung oder eine Änderung des politischen Systems? Die Abgeordneten des Parlaments bestehen darauf, dass nun sie das Sagen haben. Einige Regierungschefs wie Angela Merkel wollen sich die Entscheidung nicht aus der Hand nehmen lassen.
Nach der Wahl am 25. Mai wird entweder Junckers EVP oder Schulz' SPE die größte Fraktion im Europaparlament stellen. Davon hängt ab, wer von beiden den wichtigsten Posten in der EU für sich beansprucht. Die Spitzenkandidaten sollten Pfeffer in den Wahlkampf bringen, aber je länger sie miteinander diskutieren, desto schlechter kann man sie voneinander unterscheiden.
Eine Differenz wird deutlich, als beide Kandidaten ganz am Ende der ARD-Sendung ihre wichtigsten drei Maßnahmen als Kommissionspräsident vorstellen sollen. Beide nennen das Problem der Arbeitslosigkeit mit als erstes. Schulz will in kleine und mittlere Unternehmen investieren. Juncker will auch etwas tun, aber dafür lieber "kein Geld ausgeben, das wir nicht haben". Dahinter steht die Frage, ob der Staat - oder in diesem Fall die EU - Arbeitslosigkeit besser selbst bekämpft oder ob es besser funktioniert, gute Bedingungen für Unternehmen zu schaffen.
Wer aber genauer hinschaut, entdeckt einen noch grundsätzlicheren Unterschied: Juncker und Schulz haben eine andere Vorstellung davon, was Europa eigentlich sein soll.
Staatenbund oder Bundesstaat
In der Welt von Martin Schulz befindet sich Europa auf dem Weg, ein neuer Staat zu werden. Das kann noch lange dauern oder sich doch anders entwickeln, aber es kommt auf die Richtung an: Die Regierungschefs, die im Europäischen Rat organisiert sind, geben langsam Macht ab, das Parlament gewinnt sie hinzu. Die Kommission wird die Regierung des Mega-Staats und kann auch in Krisensituationen alleine entscheiden. Die nächtelangen Gipfeltreffen in Brüssel wären unnötig. Sobald die aktuellen Probleme Europas gelöst sind, könne man über die weitere Vertiefung nachdenken, sagt Schulz.
In der Welt von Jean-Claude Juncker ist die EU zwar auch etwas Besonderes. Doch ein neuer Staat soll sie auf keinen Fall werden. "Die Menschen wollen das nicht", sagt er in Hamburg. Das Parlament ist für ihn dazu da, den Bürgern eine Stimme zu geben - die wichtigen Entscheidungen treffen aber weiterhin die Regierungschefs. Die Kommission ist in diesem System keine Regierung, sondern eine Behörde, die im Auftrag der nationalen Regierungschefs Gesetze ausarbeitet.
Die Biografien der Kandidaten passen auf diesen Unterschied: Der bodenständige Schulz hat als Bürgermeister von Würselen angefangen und sich 20 Jahre lang als Europaparlamentarier nach oben gearbeitet. Je länger er im Parlament saß, desto mehr regte ihn auf, wie die Regierungschefs sich an die Macht klammern, obwohl sie nicht direkt gewählt sind und hinter verschlossenen Türen tagen.
Feiner Witz und Frontalangriff
Juncker war dagegen 18 Jahre lang einer dieser Regierungschefs. "Nationen sind keine provisorische Erfindung der Geschichte", sagt er. Mehr Rechte für das Parlament findet er okay. Zum Beispiel soll es eigene Gesetze auf den Weg bringen können. Er ist überzeugter Europäer, findet aber, dass weiterhin die Mitgliedstaaten den Ton angeben sollten.
In den mit Themen überladenen TV-Sendungen wird das nicht deutlich, auch in der ARD-Wahlarena nicht. Einen besseren Eindruck bekommt man bei Wahlkampfreden. Juncker berichtet da ruhig, gelassen und mit feinem Witz, wie er die Arbeit der Kommission fortführen möchte. Schulz dagegen bläst jedes Mal zum Angriff, sobald er eine Bühne betritt. Er rudert mit den Armen, schimpft über Hinterzimmerpolitik und verspricht, dass er den Regierungschefs penetrant im Nacken sitzen wird.
Besonders einig sind sich beide dann wieder, wenn es um die Frage geht, was eigentlich nach der Wahl passiert. Der EU-Vertrag macht nur eine schwammige Aussage dazu, ob das Parlament oder die Regierungschefs darüber bestimmen, wer Kommissionspräsident wird. Schulz findet sowieso, dass es das Parlament sein sollte. Juncker kann ihm nur zustimmen. Seine EVP liegt in den Prognosen vorne. Wenn die Regierungschefs die Europawahl ernst nehmen, ist er ganz nah dran an dem Job.
Quelle: ntv.de