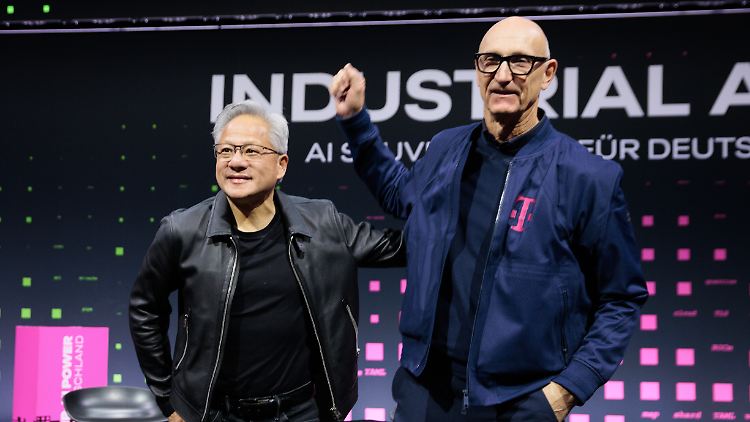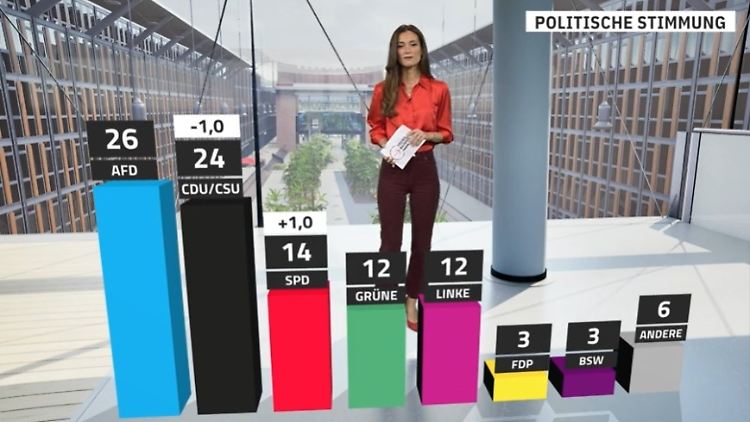Zwischenruf Limburg darf nicht überall sein
21.10.2013, 18:02 UhrDer Skandal um die Verschwendungssucht des Bischofs von Limburg ist ein Problem der römisch-katholischen Kirche, aber beileibe nicht das einzige. Die Frage ist, ob sie nach einer Radikalreform noch dieselbe wäre. Ist sich Franziskus dieses Dilemmas bewusst?
Wie bitte, soll Papst Franziskus gestöhnt haben, als Erzbischof Robert Zollitsch ihn über die dramatisch gestiegenen Kosten für den Bischofssitz zu Limburg in Kenntnis setzte. Eigentlich hätte es das Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche wissen müssen. Es stand in allen Zeitungen, dass der Umbau des Limburger Bischofssitzes statt rund fünf Millionen Euro nun mehr als das Sechsfache, wenn nicht noch mehr, kosten soll.

Papst Franziskus hat den umstrittenen Limburger Bischof Tebartz-van Elst im Vatikan zu einer Aussprache empfangen.
(Foto: dpa)
Dass Bischof Franz-Peter Tebartz-van Elst "nicht mehr nach Limburg zurückkehrt", wie die elegante Umschreibung für den erzwungenen Rücktritt des Prälaten lautet, ist nur allzu gerecht. Doch die Verschwendungssucht des Bauherrn, der selbst gern Architekt geworden wäre, ist nicht das einzige Problem.
Richtete sich der Protest der Basis des Limburger Bistums doch zuerst gegen den autoritären Führungsstil des Tebartz-van Elst. Nicht dessen "Einzelfall" ist die Krux der römischen Kirche. Es sind die über Jahrhunderte gewachsenen Strukturen, die den Vatikanstaat immer noch das sein lassen, was er fast von Anbeginn war: eine absolutistische Monarchie, in der die Lehnsherren– wenn es ihnen beliebt – so agieren, wie ihnen gerade an der Mitra ist. Hauptsache, sie stellen den Heiligen Vater nicht in Frage.
Es ist erschreckend, dass mehrere Bistümer vor ein paar Tagen vorgeblich Glasnost übten und unter dem Eindruck des Limburger Skandals Zahlen veröffentlichten, die nicht der Wahrheit entsprachen. Mit den jetzt bekannt gewordenen riesigen Vermögen der deutschen Bistümer ließen sich Armut und Not beseitigen. Damit wäre dem Anspruch, den man an Franziskus stellt, mehr als Genüge getan.
Doch halt: Franz von Assisi wollte nicht die Armut abschaffen. Sein Idealzustand war die Armut in der Nachfolge Jesu und der Jünger. Franziskus Besuch auf Lampedusa folgte nicht etwa eine Baukolonne, die Unterkünfte für die Flüchtlinge errichtete. Es blieb beim Gebet. Christus hat die Geldwechsler des Tempels nicht nur zurechtgewiesen: Er hat sie hinausgeworfen. Mit Franziskus ist der Ton erfrischend freundlicher geworden.
Aber: In keiner Grundsatzfrage hat sich seine Position im Vergleich zu der Benedikts und dessen Vorgängern geändert. Die Frage, ob es der Bergogliopapst wegen des Widerstands der Kurie und der Konservativen in den Bistümern nicht kann oder nicht will, ist schwer zu beantworten. Jede noch so ehrlich gemeinte Reform eines autoritär geführten Staatswesens hat in der Geschichte bislang stets mit dessen Zusammenbruch geendet.
Franziskus wird also bestenfalls Auswüchse wie den Fall Tebartz-van Elst oder die Sittlichkeitsverbrechen von Priestern an Kindern verhindern können und müssen. Die Ökumene wird maximal in Gesten vorankommen. Den Frauen will der Papst mehr Verantwortung übertragen – ordiniert werden sie nie und nimmer. Auch gleichgeschlechtliche Beziehungen werden keinen eheähnlichen Status bekommen. Allein für die Kommunion wiederverheirateter Geschiedener hat man im Bistum Freiburg, in Luxemburg und mehreren österreichischen Diözesen Kompromissformeln gefunden. Doch diese rütteln nicht am "moralischen Gebäude", um einmal in einem Bild des Nachfolgers Petri zu bleiben. Das Festhalten Roms an seinen Dogmen und die Kungelei mit den Herrschenden haben evangelikalen Scharlatanen, namentlich in der einstigen katholischen Hochburg Lateinamerika, zu einem ungeheuren Zulauf verholfen. Diese und andere negative Entwicklungen wird auch Franziskus nicht aufhalten können.
Eine Radikalreform würde seine Kirche "wie ein Kartenhaus zusammenfallen lassen", um ein weiteres Wort von ihm zu gebrauchen. Doch dann wäre es keine katholische Kirche mehr. Bei allen Problemen: Der Glaube wird gebraucht. Er gibt Millionen Menschen Hoffnung. Vielen hilft die Kirche auch durch ihre karitativen Aktivitäten. Da ist ein Tebartz-van Elst fehl am Platze. Ein Limburg reicht.
Manfred Bleskin kommentiert seit 1993 das politische Geschehen für n-tv. Er war zudem Gastgeber und Moderator verschiedener Sendungen. Seit 2008 ist Manfred Bleskin Redaktionsmitglied in unserem Hauptstadtstudio in Berlin.
Quelle: ntv.de