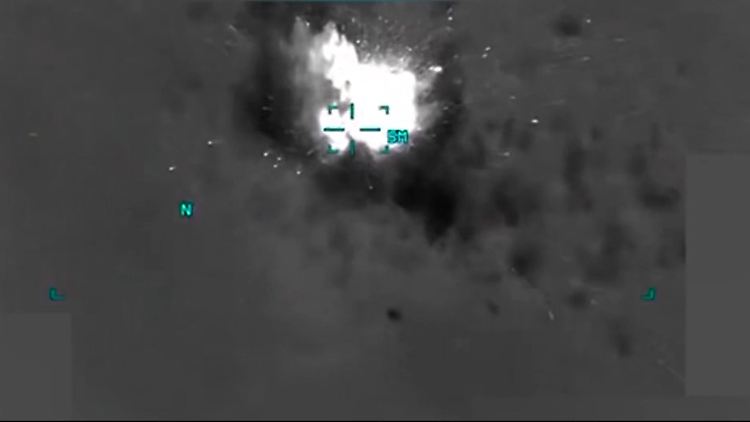Gerhardt über Liberalismus, FDP und Religion "Manchmal leide ich mit der Partei"
04.08.2012, 13:00 Uhr
(Foto: picture alliance / dpa)
Wolfgang Gerhardt, Jahrgang 1943, ist ein liberales Urgestein, war Vorsitzender und Fraktionschef der FDP im Bundestag. Heute ist der Bundestagsabgeordnete Chef der liberalen Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit. n-tv.de spricht mit dem gebürtigen Hessen über seinen marxistischen Lehrer, den Zustand seiner Partei und die Bedeutung eines Rheingauer Rieslings.
n-tv.de: Herr Gerhardt, mache ich etwas falsch, wenn ich Sie den letzten Liberalen nenne?
Wolfgang Gerhardt: Nein (lacht). Aber ernsthaft: Es gibt noch eine große Menge von Parteimitgliedern, die dieselben Vorstellungen von Liberalismus haben wie ich.
Der Liberalismus hat in der deutschen Geschichte eine große Rolle gespielt, angefangen bei der Nationalversammlung in der Frankfurter Paulskirche 1848. Aber brauchen wir Liberalismus heute noch?
Auf jeden Fall. Liberalismus ist ein Stück Aufklärung. Er ist eine politische Konzeption, die nicht alles vom Staat erwartet; er ist die präziseste Herausforderung für persönliche Verantwortung. Der Liberalismus hat eine Vorstellung von Freiheit, die für moderne Gesellschaften unverzichtbar ist.
Stichwort Freiheit: Sie sind auch Vorstandsvorsitzender der Friedrich-Naumann-Stiftung, die seit 2007 den Zusatz "für die Freiheit" im Namen trägt. Was bedeutet Freiheit für Sie?
Freiheit bedeutet, dass die Menschen unter demokratischen Spielregeln, unter demokratisch legitimierten Gesetzen ihr eigenes Leben gestalten, ihre eigene Biografie schreiben können.
"Wer sich auf die Reihenfolge Gleichheit vor Freiheit einlässt", haben Sie den großen Liberalen Rolf Dahrendorf einmal zitiert "der kommt mit einiger Sicherheit nie zur Freiheit." Vor Gott und dem Gesetz sind doch alle Menschen gleich.
Ja, aber sie sind deshalb nicht identisch, sondern unterschiedlich, haben Vorzüge und Nachteile; einer ist erfolgreicher als der andere. Individualität verstehe ich als Reichtum, nicht als Problem. Es hat einmal den Versuch gegeben, Neidvermeidungsgesellschaften zu gründen. Nehmen wir den Kommunismus. Der ist grotesk gescheitert, weil er nicht akzeptieren wollte, dass Menschen unterschiedlich sind, unterschiedliche Fähigkeiten haben. Gerechtigkeit bedeutet auch, dass man den unterschiedlichen Talenten gerecht werden muss.
Wenn Menschen nun aber so untalentiert sind, dass sie untergehen können? Was bedeutet denn Freiheit für diese Menschen?
Ihnen muss man helfen. Es gibt Menschen, die nicht in der Lage sind, ihr Leben selbstbestimmt zu führen. Wenn es bei der Hilfe nur um diese Menschen ginge, hätten wir keine Probleme mit dem Sozialstaat.
Wenn Sie auf Ihr Leben als Politiker zurückblicken, was haben Sie erreicht?
Mein politisches Leben ist in vielen Phasen verlaufen. Ich war Kommunalpolitiker in meiner Heimat im hessischen Vogelsberg. Lange Jahre habe ich Landespolitik gemacht und war stellvertretender Ministerpräsident, habe Europapolitik und Bundesratspolitik als Vertreter des Landes Hessen beim Bund und bei der EU gemacht, war lange Jahre Bundes- und Fraktionsvorsitzender. Jetzt bin ich Vizepräsident der Liberalen Internationale. Also, ich kann mich über mein Leben nicht beschweren. Es hat mir viele Möglichkeiten geboten, ich habe Siege und Niederlagen erlebt. Ich bin rundum zufrieden.
Nennen Sie bitte einen wichtigen Sieg und eine Niederlage.
Der Wiedereinzug der FDP in den Hessischen Landtag 1983. Ich war gerade im November des Vorjahres zum Landesvorsitzenden gewählt worden. Niemand gab einen Pfifferling für uns, aber wir erreichten mit 7,9 Prozent ein respektables Ergebnis. Eine Niederlage war schon der Verlust der Regierungsbeteiligung 1998. Mir war damals sofort klar, dass nun eine lange Durststrecke folgen würde.
Sie sollten, im Falle einer Regierungsbeteiligung der Liberalen, 2005 Außenminister werden. Sie sind es dann 2009 auch nicht geworden. Sind Sie auf irgendjemanden neidisch?
Nein. Bin ich nicht. Ich hätte das 2005 gern gemacht, das war auch in meiner Partei unumstritten. Dann aber geht Zeit ins Land und man fragt sich, ob man noch einmal etwas Neues beginnt oder man sich auf den Abschied aus der parlamentarischen Tätigkeit vorbereitet.

Wären die Liberalenl 2005 an die Macht gekommen, hätte der Außenminister Gerhardt geheißen.
(Foto: picture-alliance/ dpa/dpaweb)
Wenn Sie jetzt noch Partei- oder Fraktionsvorsitzender der FDP wären, was würden Sie anders machen als die jetzige Parteispitze?
Ich will hier nicht über die Positionen der FDP in der Tagespolitik sprechen, sondern über eine innere Philosophie, welche die Menschen anspricht. Mir fehlt bei bestimmten politischen Schritten die Erläuterung, das Warum. Das Ganze ist zu kurzatmig. Ich glaube, dass wir ein Wählerpotential haben, das mehr über die Politik der FDP wissen will und an ihr beteiligt werden möchte.
Ihr früherer Generalsekretär Christian Lindner war mit der Ausarbeitung eines neuen Grundsatzprogramms befasst. Er hat sich aus der Bundespolitik zurückgezogen, jetzt reicht es nur für ein Eckpunkteprogramm. Was Sie fordern, wird auch jetzt nicht kommen.
Ja, leider. Für dieses Programm wurden mehrere Arbeitsgruppen gebildet. Herausgekommen ist ein voluminöses Papier. Ich hätte lieber mit einer kleinen Gruppe einen Entwurf erarbeitet, der ein Statement des politischen Liberalismus in unserer Zeit darstellt und keine Regierungserklärung. Das hat mir alles nicht gefallen. Da habe ich gesagt: "Danke!" und mich aus der Arbeit zurückgezogen.
Sie lesen viel und gern, am liebsten Biographien, haben Sie mir einmal gesagt. Haben Sie da Vorbilder für sich gefunden?
Ich habe mich immer für Geschichte interessiert. Mir ging es dabei nicht um Vorbilder, sondern um Persönlichkeiten, die von Autoren mit fundierten Kenntnissen geschrieben wurden. Nehmen Sie "Joseph Fouché" von Stefan Zweig oder Golo Manns "Wallenstein" oder Carl Jacob Burckhardt Richelieu. Man meint, die Autoren wären dabei gewesen. Ich glaube nicht an einen mechanischen Ablauf der Geschichte oder nur an große gesellschaftliche Bewegungen. Die deutsche Nachkriegsgeschichte wäre ohne Carlo Schmid, Theodor Heuss, Konrad Adenauer und andere nicht so gut verlaufen. Das waren Glücksfälle für den Neubeginn nach der Katastrophe.
Da Sie von Heuss, damals Bundespräsident und Adenauer, damals Kanzler, sprechen: Beide hatten einen Dissens über den Umgang mit dem Deutschlandlied als Nationalhymne. Heuss war dagegen, Adenauer hat sich schließlich durchgesetzt. Wie gehen Sie mit dem Lied um?
Ganz unbefangen. Die dritte Strophe ist ja nun unsere Nationalhymne. Ich hätte in der Auseinandersetzung eher auf der Seite Adenauers gestanden. Das Lied ist keine Überhöhung Deutschlands. Natürlich ist es nach der großen Katastrophe dahin gerückt worden. Aber ich bin mit der Nationalhymne der Bundesrepublik Deutschland völlig einverstanden.
Ist der Begriff "Vaterland" eine Dimension für Sie?
Ja. Der Begriff sollte nicht auf den Müllhaufen der Geschichte geworfen werden. Das Eigene zu schätzen bedeutet, die andere zu respektieren. Heute erleben wir ja, dass die Vaterländer und Nationen eine viel längere Lebensdauer haben, als wir uns jemals vorgestellt haben.
Sie haben 1963 Ihr Abitur abgelegt, in den Nachwehen der 68er-Bewegung in Marburg bei dem Marxisten Wolfgang Abendroth promoviert. Was hat Sie bewogen, Liberaler zu werden?
In meiner Studentenzeit ging es ja auch um eine neue Deutschlandpolitik. Da war die FDP führend.
Unter Walter Scheel , damals Parteivorsitzender.
Ja. Es ging unter anderem darum, die Oder-Neiße-Linie als Grenze zu Polen zu respektieren und mit den osteuropäischen Staaten zusammenzuarbeiten. Das hat sich ja dann auch als richtig erwiesen. Ich war damals im Liberalen Studentenbund in Marburg aktiv, und da ging es auch um dieses Thema. Je mehr man sich damit beschäftigte, desto eindringlicher fragte man sich selbst, ob man hier richtig ist. Die Frage habe ich mit ja beantwortet. In Marburg bin ich auch in die FDP eingetreten, was ich nie bereut habe. Ich fühle mich in dieser Partei wohl und halte sie für unbedingt notwendig in Deutschland. Manchmal leide ich mit der Partei, die sich nicht so darstellen kann, wie ich mir das wünsche. Die Bundesrepublik wäre aber sehr viel ärmer ohne diese liberale Partei.
Ich habe versucht, ein Foto von Ihnen mit langen Haaren zu finden, die ja in jener Zeit, in der Sie studierten, Mode waren. Die Revolution, welche die 68er wollten, fand nicht statt. Dafür aber die Beatrevolution. Hatten Sie damals lange Haare?
Nein. Wenn ich jetzt Ihre Frage höre, ist es eigentlich das erste Mal, dass ich mich selbst frage, warum nicht. Aber es gab für mich keinen Grund (lacht). Wahrscheinlich lag es daran, dass mich die langen Haare beim Sport behindert hätten. Ich habe aktiv Tennis gespielt.
Die Musik hat im Selbstverständnis in den 60er und 70er Jahren eine große Rolle gespielt, also die Beatles oder die Rolling Stones. Auch für Sie?
Nein, nicht so wie für andere. Ich habe mich für die Hochschulreform engagiert, für gesellschaftliche Veränderungen, für eine neue Deutschlandpolitik. Es gab ja viele Verkrustungen in der alten Bundesrepublik. Ich habe mein Leben aber nicht nur dieser Aufgabe gewidmet. Ich habe auch sehr Privates immer für wichtig erachtet. Man muss nicht jeden Abend Politik machen.
Kommen wir zur Familie. "My home ist my castle", heißt es. Was bedeutet Ihnen Ihr Heim, was Ihre Familie?
Sehr viel. Ich habe eine Frau, zwei Töchter, ein Enkelkind. Unser Heim hat sich über die Jahr zum Treffpunkt für alle entwickelt. Ich merke das an meinen Töchtern. Da denkst du, die werden irgendwann erwachsen und separieren sich von der Familie. Nach ersten Anläufen haben sie sich dann aber wieder stärker der Familie zugewandt.
Wenn Sie mal richtig down sind, was machen Sie dann? Hilft Ihnen die Familie dann?
Eigentlich habe ich keine Situationen erlebt, die es erfordert hätten, dass meine Familie um mich herumsitzt, um damit fertig zu werden.
Und was machen Sie, wenn Sie sich sagen "Das war ein toller Tag".
Dann rufe ich meinen Freund Walter Bischof in Wiesbaden an und trinke mit ihm einen Rheingauer Riesling.
Sie haben neben Germanistik und Politikwissenschaften auch Erziehungswissenschaften studiert, hätten also Lehrer werden können. Versteht sich der Politiker Gerhardt auch als Lehrer?
Ich habe die Fächer studiert, weil sie so im Lehrfach angeboten wurden. Ich habe zwar das Vorexamen für das Lehramt am Gymnasium gemacht, aber ich wollte nie Lehrer werden. Ich habe mein Studium ja auch nicht mit dem Staatsexamen abgeschlossen, was mich ins Lehramt gebracht hätte, sondern mit der Promotion.
Was war das Thema Ihrer Dissertation? Ich hab's nicht rausgefunden.
Das Thema lautete: "Die bildungspolitische Diskussion der Liberalen nach 1945". Das Thema wurde an mich, also einen Liberalen vergeben. Analog wurden gleiche Themen zur CDU und zur SPD vergeben.
War das eine Art Aufarbeitung von Geschichte?
Nein. Aber alle hatten ein Stück damit zu tun, dass sie sich grob geirrt hatten. Das humanistische Gymnasium war nicht besser als andere Schulformen, resistenter gegen autoritäres Gedankengut.
Was bedeutet Ihnen Religion?
Ich bin kein tief gottgläubiger Mensch. Ich bin evangelisch und zutiefst überzeugt davon, dass das Christentum unserer Gesellschaft in kultureller Hinsicht etwas zu bieten hat. Das sage ich als Liberaler. Wir sollten noch stärker den gegenseitigen Gedankenaustausch pflegen. Insofern gewinnt Religion eine ganz natürliche, nichtideologische Bedeutung.
Manch einer spricht von christlicher Leitkultur, andere betonen die jüdisch-christlichen Traditionen, in jüngster Zeit wird die Bedeutung des Islam für Deutschland diskutiert.
Zunächst einmal würde ich das "Leitkultur" vermeiden. Wir haben ein Grundgesetz, in dem unsere Kulturgeschichte in den Wertvorstellungen der unveräußerlichen Menschenrechte zusammengeflossen ist. Das ist für mich der Quellcode dieses Staates und seiner Werte. Dieser Quellcode wird auch aus verschiedenen religiösen Bewegungen gespeist. Aber deshalb sollten diese nicht die Oberhand gewinnen. Unser Quellcode ist das Produkt der Aufklärung, der Renaissance, der Entwicklung des Christentums, der Trennung von Staat und Kirche, so wie es Heinrich August Winkler, der große Historiker, gesagt hat. Wir haben Glück gehabt, dass wir in Europa eine solche Entwicklung genommen haben.
Wenn Sie in die Zukunft blicken, was wünschen Sie sich?
Ich bin mit meinem Leben ganz zufrieden. Ich werde die Arbeit in der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit fortführen und natürlich auch mein Engagement in der Liberalen Internationale. Aber ich möchte noch einmal, und das habe ich ja schon angedeutet, eine Art Manifest zum Thema "Politischer Liberalismus auf der Höhe der Zeit" entwerfen.
Quelle: ntv.de, Mit Wolfgang Gerhardt sprach Manfred Bleskin