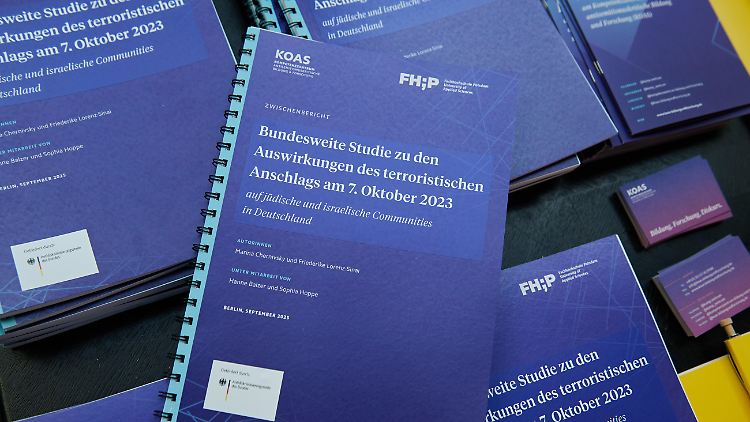"Es bleibt einiges zu tun" Merkel sieht Einheit nicht vollendet
03.10.2013, 13:36 Uhr
Gruppenbild mit Dame: Der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann, Bundestagspräsident Norbert Lammert, Bundespräsident Joachim Gauck, Kanzlerin Angela Merkel und der Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Andreas Voßkuhle feiern die Einheit (v.l).
(Foto: dpa)
Am Tag der Einheit zieht Kanzlerin Merkel Bilanz und trübt ein wenig die Feierstimmung: Es gibt noch Unterschiede in Deutschland. Dies zeigt sich allein beim unterschiedlichen Rentenniveau, mit dem sich ostdeutsche Ministerpräsidenten nicht mehr abfinden wollen.
Bundeskanzlerin Angela Merkel sieht auch 23 Jahre nach der Wiedervereinigung Defizite bei der Angleichung der Lebensverhältnisse in Deutschland. "Es bleibt einiges zu tun", sagte die CDU-Politikern bei der zentralen Feier zum Tag der Deutschen Einheit in Stuttgart. Im Osten sei die Arbeitslosigkeit höher als im Westen und im Westen seien die Gehälter höher als im Osten. Merkel dankte allen, die sich für die Wiedervereinigung eingesetzt haben. Explizit nannte sie Bürgerrechtler in der früheren DDR.
Bundespräsident Joachim Gauck verlangte von der künftigen Bundesregierung, außenpolitisch noch selbstbewusster aufzutreten. Er wies auf die wachsenden Anforderungen aus dem Ausland an Deutschland hin. Da Deutschland einen ständigen Platz im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen anstrebe, müsse es sich auch fragen, welche Rolle es bereit sei, bei Krisen in ferneren Weltregionen zu spielen. "Ich mag mir nicht vorstellen, dass Deutschland sich groß macht, um andere zu bevormunden. Ich mag mir aber genau so wenig vorstellen, dass Deutschland sich klein macht, um Risiken und Solidarität zu umgehen", sagte Gauck.
Bundesratspräsident Winfried Kretschmann verlangte eine Stärkung des Föderalismus in Deutschland und Europa. Die Bundesländer müssten ausreichend finanzielle Mittel haben, damit sie ihre Aufgaben gut erfüllen können. "Das Thema Finanzbeziehungen steht bald unweigerlich auf der Tagesordnung", sagte Baden-Württembergs Regierungschef. Mit einer Reform des Länderfinanzausgleichs müsse dafür gesorgt werden, "dass Nehmerländer sich kräftigen und weiterentwickeln und Geberländer nicht dauerhaft überfordert werden".
Noch immer unterschiedliche Renten
Zum Tag der Deutschen Einheiten bricht auch die Diskussion um die Angleichung der Renten wieder auf. Die Ministerpräsidenten von Thüringen und Mecklenburg-Vorpommern, Christine Lieberknecht (CDU) und Erwin Sellering (SPD), erwarten von der neuen Bundesregierung die Anhebung der Ost-Renten auf Westniveau. "Unabhängig davon, wer mit der Union letztlich regiert, die Rentenangleichung muss als Aufgabe in den Koalitionsvertrag", sagte Lieberknecht.
Spätestens mit Ablauf der Legislaturperiode 2017 dürfe es keine Unterschiede mehr bei der Rentenberechnung geben. Derzeit liege der Rentenwert Ost bei 91,5 Prozent des Westniveaus.
Sellering sagte: "Die Angleichung muss endlich kommen. Schwarz-Gelb hatte sie als Ziel im Koalitionsvertrag, das Versprechen aber nicht gehalten." Die SPD habe daher die Rentenangleichung erneut in ihr Wahlprogramm aufgenommen. Sie will die Angleichung bis 2020 "auf den Weg bringen", die Grünen möchten sie so schnell wie möglich umsetzen.
Nach Sellerings Einschätzung kann die Anpassung nur im Einvernehmen mit den westdeutschen Bundesländern gelingen. "Die Lösung wird nicht einfach sein." Er kenne die Diskussionen darüber, dass Frauen im Osten heute höhere Renten beziehen als Frauen im Westen. "Das ist doch aber auch gerechtfertigt, wenn die einen 40 Jahre und die anderen 15 Jahre gearbeitet haben", sagte er.
Zudem müssten neben Einzelrenten auch die Einkommen der Rentnerhaushalte verglichen werden. "So etwas wie Betriebsrenten gibt es im Osten so gut wie nicht. Und die meist höheren Pensionen werden bislang auch vorwiegend im Westen gezahlt", sagte der SPD-Politiker. Die gesetzliche Rente sei meist die einzige Säule der Alterssicherung im Osten. Wegen der Massenarbeitslosigkeit in den Nachwendejahren drohe vielen Ostdeutschen nun zudem Altersarmut.
Diskussion um Soli
Auch um den Solidaritätszuschlag gibt es wieder eine Debatte. Saarlands Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer zeigte sich offen für einen Vorschlag aus der SPD, das Aufkommen des Solidaritätszuschlags für den Aufbau Ost in Zukunft zur Schuldentilgung aller Bundesländer einzusetzen. "Der Soli ist eine gute Möglichkeit, sich dem Thema Altschulden zu nähern", sagte sie der "Welt". Die Länder sollten eine gemeinsame Position entwickeln, wie es 2019 nach dem Ende des Solidarpakts II mit dem Solidaritätszuschlag weitergehen solle. Das Modell von Hamburgs Bürgermeister Olaf Scholz (SPD) sollten die Länder dabei "ernsthaft prüfen".
Der stellvertretende SPD-Vorsitzende Scholz hatte im September angeregt, die Einnahmen aus dem Solidaritätszuschlag allen Ländern zukommen zu lassen, damit diese ihre jahrzehntelang gewachsenen Schulden zurückzahlen könnten. Den Solidaritätszuschlag könne es nicht begründungsfrei über das Ende des Solidarpakts 2019 hinaus geben. Wichtig sei eine gemeinsame Schuldenpolitik von Bund und Ländern. Bisher fließen die Einnahmen aus dem Soli allein an den Bund.
Quelle: ntv.de, jtw/ghö/dpa/AFP