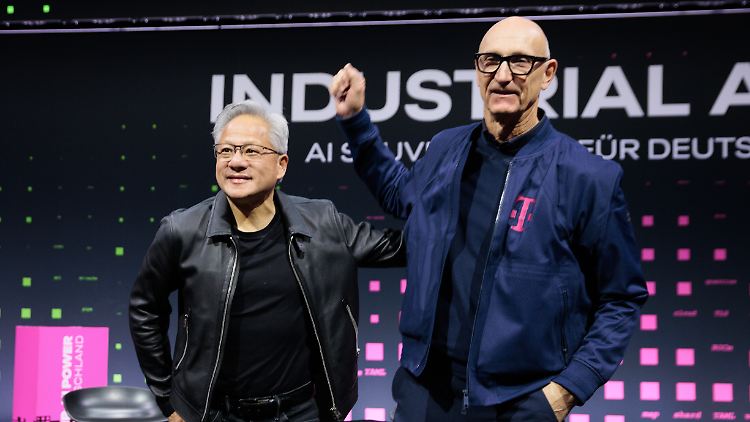Alles ganz anders Mythos und Wahrheit
01.03.2008, 17:39 UhrManche Mythen ranken sich um den spektakulären Präsidentschafts-Wahlkampf in den USA. Obwohl es derzeit erst um die Nominierung der Kandidaten geht, verfolgt die Welt gebannt wie selten zuvor den gigantischsten und teuersten Wahlkampf in der Geschichte der Demokratien. Dabei gibt es manche weit verbreiteten Irrtümer und Illusionen über die Wahl in den USA.
"2009 enden die transatlantischen Spannungen."
Manche in Berlin fürchten das Gegenteil, wie jüngst ein deutsches Kabinettsmitglied in Washington gestand. Auch wenn mit Barack Obama oder Hillary Clinton ein Demokrat ins Weiße Haus einzöge, würde er die Europäer in Afghanistan und anderswo zu verstärktem Engagement drängen. Obamas zornige Worte über Europäer, die Amerikanern und Briten "die Drecksarbeit" überließen, belegen die deutschen Sorgen.
Erschwerend komme hinzu, dass beim Amtsantritt des neuen US-Präsidenten in Deutschland die Bundestagswahl ihre Schatten voraus werfen werde. Da die Bereitschaft der Bundesbürger zu verstärktem weltweitem Militäreinsatz sehr gering sei, drohe 2009 ein besonders schwieriges Jahr in den amerikanisch-europäischen Beziehungen zu werden. Der unbeliebte Bush sei bisher "ein bequemes Alibi" in Deutschland gegen US-Wünsche gewesen.
"Obama oder Clinton werden den Irakkrieg beenden."
Erhebliche Zweifel scheinen angebracht. Beide wollen zwar "unverzüglich beginnen", die US-Truppen abzuziehen. Aber beide betonen auch, sie würden nicht zulassen, dass der Irak ins politische Chaos falle und eine Basis für El Kaida und andere Extremisten werde. "Ungeachtet aller Wahlkampf-Rhetorik" würden auch unter einem demokratischen Präsidenten viele US-Truppen im Irak bleiben, schrieb nüchtern der konservative "Wall Street Journal". Allerdings kann sich der republikanische Kandidat John McCain US-Truppen sogar noch "in 100 Jahren" im Irak vorstellen.
"Geld entscheidet die Wahl."
Ja und Nein. Zwar wird dieser Wahlkampf weit mehr als eine Milliarde Dollar kosten; Aber Geld allein entscheidet kaum über den Einzug ins Weiße Haus. McCain und Obama waren finanziell gesehen eher Außenseiter. McCains Wahlkampfkasse war im Spätsommer 2007 schon fast leer, während sein Parteirivale, der schwerreiche Mitt Romney, schon früh enorme Summen investierte. Auch Hillary Clinton hatte bei den Finanzen lange die Nase vorn. Und im Wahlkampf 2004 wurden jüngsten Analysen zufolge für den Sieg George W. Bushs weniger Geld eingesetzt als für den unterlegenen demokratischen Herausforderer John Kerry.
"Die Reichen bestimmen die Kandidaten."
Politiker, die nicht zig- Millionen Dollar sammeln können, sind ohne Chance. Trotz strenger Gesetze über Parteispenden kanalisieren Konzerne und Milliardäre viel Geld in den Wahlkampf. Allerdings unterstützen sie meist mehrere konkurrierende Politiker, auch, um sich dem Vorwurf der Einseitigkeit zu entziehen. Aber Wahlkampfgelder kommen von überall: Obamas Wahlkampfkasse füllten vor allem Hunderttausende Kleinspender. Auch Howard Dean (2004) oder Mike Huckabee und Ron Paul (beide Republikaner) erhielten ihr Geld überwiegend von einfachen Bürgern.
"Opas Wahlkampf ist tot."
Klinkenputzen und der direkte Kontakt zu den Bürgern war vor allem in Bundesstaaten, in denen bei einem Caucus (Art lokaler Parteiversammlung) abgestimmt wurde, wichtig. Bürgerversammlungen gelten auch in einer Demokratie mit 300 Millionen Einwohnern als ein wichtiger Schlüssel für den Erfolg. Insbesondere McCain und Obama traten in Hunderten solcher Veranstaltungen auf. Sie mobilisieren und motivieren Hunderttausende lokaler Wahlkämpfer. Regionale Sender garantieren eine Resonanz weit über die Versammlungen hinaus. Auch deswegen machen Obama, Clinton oder McCain die politische Ochsentour bis tief in die amerikanische Provinz.
"Das Wahlsystem stärkt die Mächtigen."
Das Gegenteil war diesmal der Fall. Ohne die zeitliche Staffelung der Vorwahlen wären die Favoriten des Herbstes, Clinton und bei den Republikanern Rudy Giuliani, nach Einschätzung von Wahlkampfexperten wie Michael McDonald vom Brookings-Institut in Washington längst Präsidentschaftskandidaten. Erfolgreiche Wahlkämpfe vor allem in bevölkerungsarmen Staaten gaben den Außenseitern Obama und Huckebee den nötigen Aufwind. Und die zahlreichen Debatten geben selbst extremen Außenseitern wie dem demokratischen Pazifisten Donald Kucinich oder dem radikalen Isolationisten Ron Paul ein Podium.
"Show und Spektakel prägen die Wahlen."
Allein die demokratischen Kandidaten mussten bisher 20 Fernseh-Debatten durchstehen. Zunächst galt es, sich unter neun Konkurrenten zu profilieren. Nach jeder Sendung sezieren politische Gegner und Medien jede Formulierung auf Fehler und Schwachstellen. Aussetzer wie Clintons Unfähigkeit, den Namen des wahrscheinlichen neuen russischen Präsidenten Dmitri Medwedew auszusprechen, oder Obamas Bombendrohung gegen Pakistan werden im Fernsehen unzählige Male wiederholt. Der lange Prozess der Vorwahlen sei wichtig, weil die Bürger sehen könnten, wie Politiker Stress bewältigten und ob sie die "innere Kraft" fürs Präsidenten-Amt haben, meinte Bush kürzlich.
Quelle: ntv.de