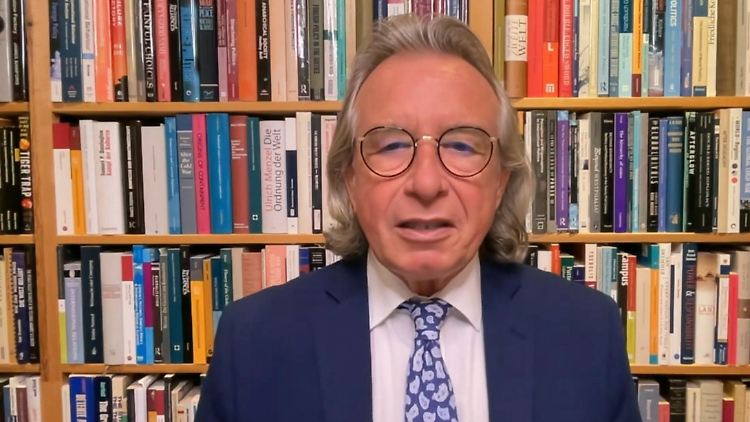Im Zeichen knapper Kassen Schwierige Tarifgespräche
13.01.2010, 18:46 UhrOhne erkennbare Annäherung haben in Potsdam die Tarifverhandlungen für die rund 1,3 Millionen Angestellten des öffentlichen Dienstes von Bund und Kommunen begonnen. Die Gewerkschaften beharren auf ihrer Forderung nach einem fünfprozentigen Lohnzuwachs; die Arbeitgeberseite nennt dies "maßlos".

Verdi-Chef Bsirske: Fünf Prozent mehr Lohn sind fünf Prozent mehr Kaufkraft.
(Foto: picture alliance / dpa)
Die Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst sind gestartet. Nach mehr als vier Stunden war in Potsdam noch kein Fortschritt erkennbar. Arbeitgeber und Gewerkschaften haben sich auf schwierige Gespräche eingerichtet. Für die 1,2 Millionen Tarifangestellten bei Bund und Kommunen sind Verbesserungen im Gesamtumfang von 5 Prozent gefordert. Der Verhandlungsführer des Bundes, Innenminister Thomas de Maizière (CDU), wies die Forderung vor Gesprächsbeginn als "maßlos" zurück. Ein Angebot legte die Arbeitgeberseite nicht vor.
Zudem sei die Forderung zu unbestimmt, sagte de Maizière. "Wir wissen nicht, wie sich das zusammensetzt und wie das ausgegeben werden soll." Für die Beschäftigen außerhalb des öffentlichen Dienstes sei die Forderung unverständlich. Als Orientierungsmarke gilt für die Arbeitgeber der Abschluss für die Bediensteten der Länder von plus 1,2 Prozent. Eine solche Erhöhung gleicht voraussichtlich die Inflationsrate aus.
Kritik am Wachstumsbeschleunigungsgesetz
Verdi-Chef Frank Bsirske kritisierte vor Verhandlungsbeginn das milliardenschwere Wachstumsbeschleunigungsgesetz der Bundesregierung. Es diene dem Wachstum mehr, wenn man im öffentlichen Dienst auf Lohnerhöhung setze. "Und nur mit einer gestärkten Kaufkraft der Beschäftigten im öffentlichen Dienst ist die Kaufkraft voranzubringen", sagte Bsirske.
Frank Stöhr betonte als Chef der Tarifunion des Beamtenbundes (DBB), man dürfe nicht nur an die Haushalte der Kommunen und des Bundes denken, sondern auch an die Haushalte der Beschäftigten. Zuvor hatte er die in Aussicht gestellte Erhöhung der Gehälter um 1,2 Prozent "als Schritt in die richtige Richtung" gewertet. Für die schwierige Haushaltslage der Kommunen seien nicht die Beschäftigten verantwortlich zu machen.
Warnstreiks nicht ausgeschlossen
Sollten sich die Arbeitgebervertreter bis zur dritten Verhandlungsrunde Mitte Februar nicht bewegt haben, planen die Gewerkschaften Warnstreiks und Demonstrationen. Zu ihrem Forderungskatalog gehören auch eine tarifvertraglich abgesicherte Altersteilzeit sowie Verbesserungen für Auszubildende. Als nächste Verhandlungstermine stehen das letzte Januar-Wochenende sowie der 10./11. Februar bereits fest.
Fünf Prozent "nicht verkraftbar"
Minister de Maizière verwies auf den Rückgang der gesamtwirtschaftlichen Leistung in Deutschland im vergangenen Jahr um 5 Prozent. Die Realeinkommen der Beschäftigten würden bei steigender Arbeitslosigkeit wohl um 1,2 Prozent sinken. Zu berücksichtigen sei auch, dass es für die Beschäftigten von Bund und Kommunen einen Lohnzuwachs von 8 Prozent in den vergangenen zwei Jahren gegeben habe.
Der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetages, Stephan Articus, sagte im WDR, für die Kommunen sei eine fünfprozentige Tariferhöhung "nicht verkraftbar". Sein Kollege vom Städte- und Gemeindebund, Gerd Landsberg, sagte der "Leipziger Volkszeitung", für viele Kommunen sei eine solche Erhöhung "nicht bezahlbar". Der Handlungsspielraum sei angesichts der Wirtschafts- und Finanzkrise minimal.
Quelle: ntv.de, dpa