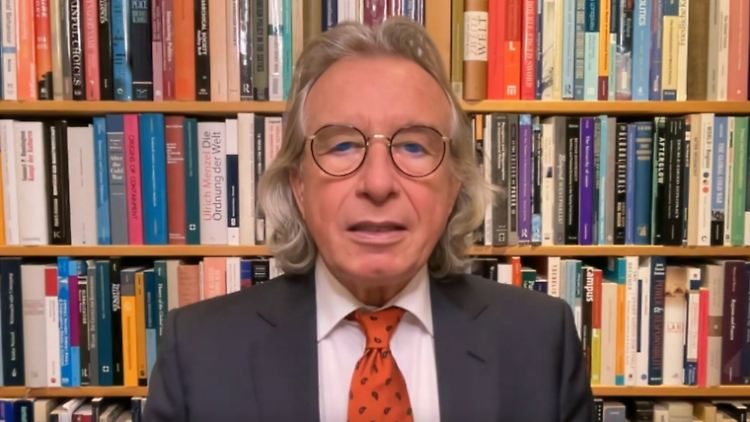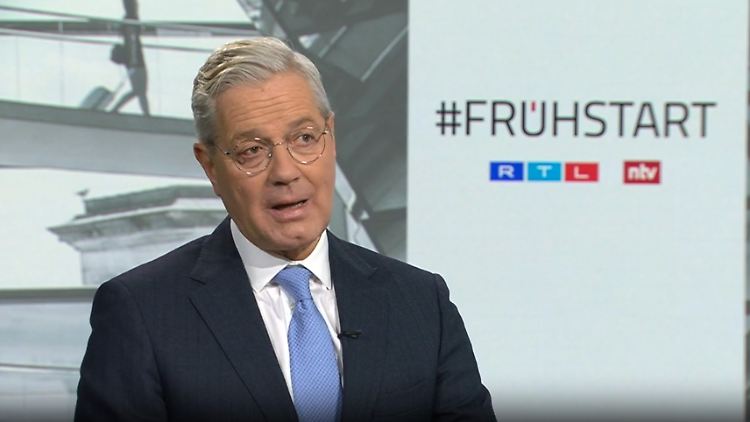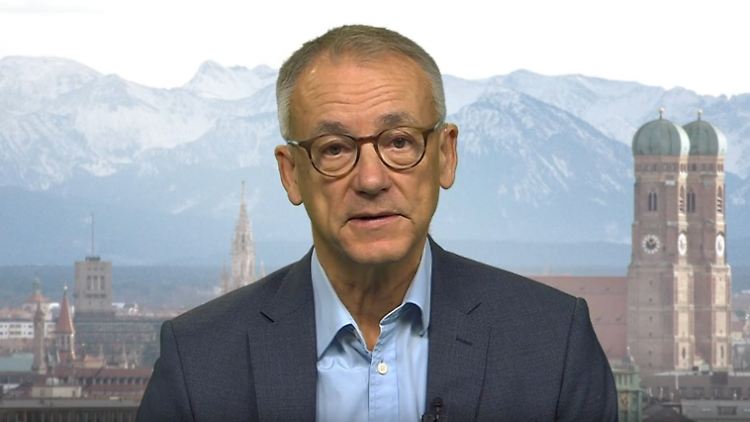Stillstand in Sozialpolitik als Wahltaktik? Städte kritisieren Regierung
06.08.2012, 16:20 Uhr
Höhere Kosten, gleiche Geburtenrate?
(Foto: dapd)
Leistungen für Familien in Deutschland kosten Städte und Kommunen 123 Milliarden Euro pro Jahr. Zu viel? "Das Gesamtsystem muss auf den Prüfstand", so die Forderung der Kommunalvertreter. Zwar gibt es bereits eine entsprechende Studie, doch die Bundesregierung verschleppe die Bekanntgabe der Ergebnisse, so der Vorwurf.
Die unter hohen Kosten für bedürftige Familien und Behinderte leidenden Kommunen machen sich für eine grundlegende Reform des Sozialstaates stark. Der Deutsche Städte- und Gemeindebund (DStGB) forderte die Einsetzung eines unabhängigen Expertengremiums nach dem Vorbild der Hartz-Kommission. Allein für Familien gebe es 152 Leistungen, die 123 Milliarden Euro im Jahr kosteten, kritisierte DStGB-Präsident Roland Schäfer. Die Geburtenrate sei aber nicht höher als in anderen Ländern.
Die Bundesregierung wies den Vorwurf der Kommunen zurück, sie verschleppe einen Bericht über die Effekte der Familienpolitik. Das über Jahre gewachsene, "fast undurchdringliche Sozialdickicht" müsse durchforstet und das System auf seine Wirkung hin abgeklopft werden, sagte Schäfer. Der Sozialstaat müsse völlig reformiert werden: "Das Gesamtsystem muss auf den Prüfstand."
Schäfer hat für das geforderte Projekt bereits einen Namen: "Wir brauchen eine Agenda 2020, mit der die notwendigen Reformen unserer Gesellschaft eingeleitet werden", forderte er. Wie bei der Energiewende sei ein Umsteuern notwendig, um den Weg aus dem Schuldenstaat zu finden. Für die Kommunen liegt der Schlüssel vor allem bei den Sozialleistungen, an denen sie mit 45 Milliarden Euro im Jahr beteiligt sind.
Kassenkredite keine Lösung
Der Bund hat den Städten und Gemeinden zwar bereits zugesagt, sie bis 2014 von den Kosten der Grundsicherung im Alter zu entlasten, die sich auf gut vier Milliarden Euro im Jahr summieren. Zudem versprach die Bundesregierung, sich an der Eingliederungshilfe für Behinderte zu beteiligen, die jährlich mit knapp 14 Milliarden Euro zu Buche schlägt.
Diese Zusagen reichen aus Sicht der Städte und Gemeinden allerdings nicht aus. Ihnen ist die finanzielle Decke auch im Aufschwung zu kurz: Zwar dürften die Kommunen 2012 erstmals seit Jahren wieder einen leichten Überschuss in ihren Kassen haben, sagte Schäfer. In der Krise seien die kurzfristigen Kassenkredite, mit denen sich viele Gemeinden über Wasser halten, aber auf den Rekordwert von 45 Milliarden Euro gestiegen.
Nachdem alle Versuche gescheitert sind, den Städten und Gemeinden über eine Reform der schwankungsanfälligen Gewerbesteuer eine solidere Einnahmebasis zu verschaffen, konzentrieren sich die Kommunen nun auf ihre stark steigenden Ausgaben im Sozialbereich. Dabei sehen sie den Bund stärker der Pflicht. So ist aus Sicht des DStGB das Risiko einer Behinderung ein allgemeines Lebensrisiko und damit Sache des Bundes und nicht der Kommune der betroffenen Bürger.
Der Streit zwischen Bund, Ländern und Gemeinden über die Sozialkosten erklärt sich bereits aus den enormen Summen. Neben den 123 Milliarden Euro für Familien werden allein weitere 24 Milliarden Euro für Sozialhilfe und 25,4 Milliarden Euro für die Kinder- und Jugendhilfe fällig. Welche Leistungsansprüche im Einzelfall bestehen, durchschauen selbst Experten kaum noch.
"Politisch vermint"
Licht in dieses Sozialdickicht könnte ein Bericht zu den Effekten der Sozialpolitik bringen - den die Regierung aus Sicht des DStGB verschleppt. Von der Expertenkommission erhoffen sich die Kommunen endlich Fortschritte.
Es gehe nicht in erster Linie um Kürzungen, so DStGB-Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg. Der Reformbedarf werde auch von den Parteien anerkannt. Die geforderte Kommission könnte dafür eine Grundlage schaffen. Aber: "Die gesamte Sozialpolitik ist natürlich politisch vermint. Wer sich da an einer falschen Stelle meldet, der verliert 'ne Wahl. Das ist der Klassiker."
Das Familienministerium wies den Vorwurf zurück, es bleibe den Bericht schuldig, der Ende 2009 in Auftrag gegeben worden sei. Es sei immer klar gewesen, dass er nach vier Jahren veröffentlicht werden solle. Zugleich betonte ein Sprecher, am Ende werde keine Zahl stehen, wie viel gespart werden könne. Ziel sei vielmehr, Wechselwirkungen einzelner Leistungen zu erforschen und herausfinden, mit welcher Maßnahme man besser und mit welcher schlechter helfen könne.
Quelle: ntv.de, dpa/rts