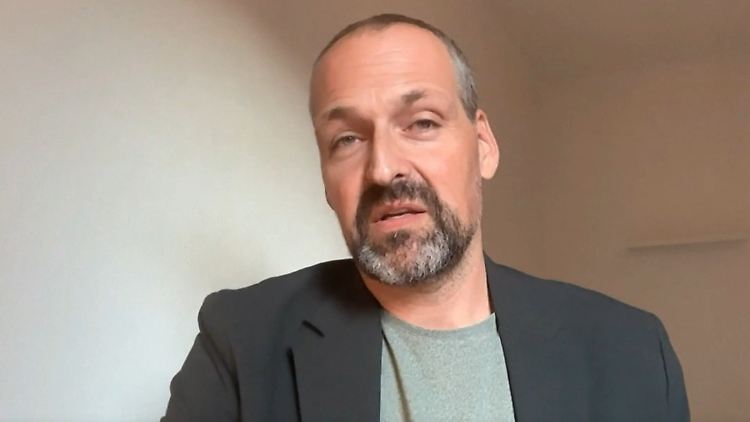Qualität in der Pflege Tausende unrechtmäßig gefesselt
24.04.2012, 18:15 Uhr
(Foto: picture alliance / dpa)
Der jüngste Qualitätsbericht zur Heimpflege offenbart: Immer noch werden viele Bewohner in ihren Bewegungsmöglichkeiten eingeschränkt, teilweise ohne die nötige Erlaubnis. Zudem werden oft Medikamente zur Ruhigstellung verabreicht. Laut Medizinischem Dienst der Krankenkassen gibt es aber auch sehr positive Entwicklungen in den Pflegeheimen.
Eine nach hinten gestellte Liege, nach oben gezogene Bettgitter, das Anbringen eines Tischbrettes oder klassische Hand- und Fußfesseln: In deutschen Pflegeheimen werden tausende Menschen regelmäßig fixiert und so an der freien Bewegung gehindert. Der Medizinische Dienst der Krankenkassen hat in seinem dritten, diesmal repräsentativen Pflegequalitätsbericht bei rund 20 Prozent der Pflegeheimbewohner so genannte freiheitseinschränkende Maßnahmen festgestellt. In 90 Prozent dieser Fälle hätten die notwendigen richterlichen Beschlüsse vorgelegen, hieß es. In 10 Prozent der Fälle jedoch nicht – die Fixierung erfolgte also unrechtmäßig. "Diese Zahl ist problematisch", so Gernot Kiefer, Vorstand des Spitzenverbandes der Gesetzlichen Krankenversicherungen, auf Nachfrage von n-tv.de.
Diese "Problematik" verdeutlichen die nackten Zahlen. Von den etwa 700.000 Bewohnern in stationären Pflegeeinrichtungen wurden 140.000 bereits mindestens ein Mal fixiert. Und davon wiederum 14.000 ohne den notwendigen richterlichen Beschluss. Betroffen sind häufig Menschen, die dement sind. Also Bewohner, die ständig weglaufen wollen, dauerhaft motorisch unruhig oder stark desorientiert sind. Sie machen bereits mehr als 60 Prozent der Heimbewohner aus. Andreas Haupt, Heimleiter und Chef des Pflegenetzes Heilbronn, gibt jedoch zu bedenken, dass es sich bei Fixierungen häufig um die Benutzung von Bettgittern handle und dies oft einem Sicherheitsgedanken des Pflegepersonals entspringe, weniger einem Wunsch nach Entlastung. "Allerdings", so Haupt zu n-tv.de, "muss den Fällen, in denen der Bewegungsdrang direkt eingeschränkt wurde, unbedingt nachgegangen werden."
Nicht erfasst sind die Fälle der sogenannten chemischen Fixierung. Ärzte verschreiben dabei stark beruhigende Medikamente. Schnell abhängig machende Schlafmittel etwa. Aber auch Neuroleptika, die eigentlich bei psychischen Erkrankungen eingesetzt werden, aber auch eine erhebliche Dämpfung des Bewegungsdrangs zur Folge haben. Peter Pick, Geschäftsführer des Medizinischen Dienstes, bestätigt auf Nachfrage von n-tv.de: "Es gibt zu viele ruhig stellende Medikamente seitens der Ärzte." Dies könne jedoch nicht der Pflegeeinrichtung zugeordnet werden. "Hier müssen die Ärzte umdenken", so Pick. Ähnlich sieht Haupt das Problem, der bestätigt, dass Ärzte nicht gerade geizen mit Beruhigungsmitteln. Die medikamentöse Behandlung sei an sich jedoch kein Fehler, so der Pflege-Experte. Das Problem entstehe eher durch eine zu hohe Dosierung. "Hier sind Pflege-Fachkräfte gefordert, die Reaktion auf Medikamente genau zu beobachten."
Doch ausgerechnet an dieser Stelle haben die Einrichtungen laut Medizinischem Dienst noch ein ganz anderes Problem. Bei den 95 Prozent der Bewohner, die Hilfe beim Umgang mit Arzneimitteln brauchen, ist in 18,2 Prozent der Fälle die pflegerische Hilfe nicht sachgerecht gewesen, heißt es in dem Bericht. Oft würden etwa die falschen Medikamente vorbereitet oder eine falsche Dosierung verabreicht.
An anderen Stellen sieht der Medizinische Dienst die Pflege auf dem richtigen Weg. "Die gute Nachricht ist, dass sich die Qualität der Pflege positiv weiterentwickelt hat", sagt Kiefer. Er betont allerdings: "Die Tatsache, dass es insgesamt besser geworden ist, heißt nicht, dass es überall gut ist." So hat sich etwa flächendeckend in Sachen Ernährung viel getan. Ein Ergebnis auch der öffentlichen Diskussion über die Versorgung von Pflegebedürftigen mit Getränken, stellt Pick fest. Und konkret: Bei 95 Prozent der Heimbewohner ist der Ernährungszustand in Ordnung, bei 5 Prozent gibt es Defizite. Der "pflegerische Erfüllungsgrad" hat sich bei den hier erforderlichen Handlungen im Vergleich zu 2007 von 64 auf rund 80 Prozent stark verbessert.
Fachkräfte fehlen
Gleichbleibend ist die Qualität bei der Vermeidung von Druckgeschwüren, einer häufigen Komplikation bei Bettlägerigen. Bei 60 Prozent der Betroffenen setzten die Pflegekräfte entsprechende Vorbeugung um, in 40 Prozent gab es Versäumnisse. Etwas mehr als 4 Prozent der erfassten Bewohner waren zum Zeitpunkt der Untersuchung wundgelegen, hatten also einen Dekubitus. Pflege-Experte Haupt gibt zu bedenken: "Viele kommen schon mit einem Druckgeschwür in die Einrichtung." Allerdings greife gerade in Sachen Dekubitus extrem der grassierende Fachkräftemängel. Teilweise fehle es dadurch an der nötigen Kompetenz in der Krankenbeobachtung, so Haupt. "Und natürlich spielt der Faktor Zeit eine Rolle."
Insgesamt bewährt hat sich laut Bericht die Entwicklung von Standards im Umgang mit Bewohnern. Dort, wo einheitliche Pflege auf Basis der jüngsten Forschung durchgeführt werde, gebe es das größte Verbesserungspotential. So sei inzwischen "die Mehrheit der Heimbewohner gut versorgt, die Minderheit schlecht", resümiert Pick. Dort gebe es akuten Handlungsbedarf.
Einen Ansatz sieht Heimleiter Haupt in einer anderen Herangehensweise an die Überprüfung der pflegerischen Qualität – er kritisiert damit auch den vom Medizinischen Dienst vorgelegten Bericht. Die Überprüfungen der Einrichtungen würden von Pflegekräften als reine Kontrolle wahrgenommen, seien auch eine psychische Belastung. Haupt plädiert für ein begleitendes, eher beratendes Auftreten des Medizinischen Dienstes. Zudem dürfe das Ergebnis nicht in Noten veröffentlicht werden. "Ein Sternesystem ist viel aufbauender", so Haupt. Noten seien negativ besetzt und würden unter Pflegekräften als "nicht motivierend" gelten. Die Verbesserungen seit 2007 führen die Kassen jedoch gerade auf ihre Prüfungen zurück. Dadurch gebe es eine Qualitätsdiskussion in den Einrichtungen, sagt Kiefer. Er gesteht aber ein: Die im Internet abrufbaren Pflegenoten für die einzelnen Heime müssten noch aussagekräftiger werden.
Quelle: ntv.de