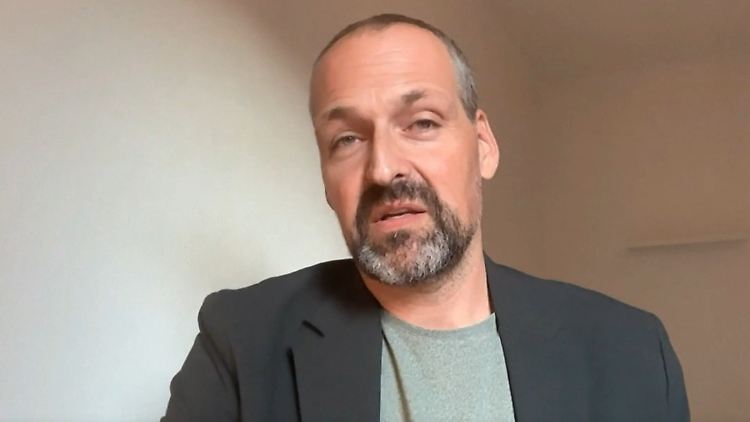Frauen an die Macht 90 Jahre Frauenwahlrecht
26.01.2009, 07:00 UhrEs ist ihr Tag. Endlich können sie in der Politik mitmischen. Am 19. Januar 1919 dürfen die deutschen Frauen zum ersten Mal wählen und sich zur Wahl stellen. Kurz nach dem Ersten Weltkrieg gelingt ihnen damit ein Riesenschritt auf dem Weg zur modernen Frau. Dass beide Geschlechter die gleichen politischen Rechte haben, wirkt im Superwahljahr 2009 und mit Angela Merkel als deutsche Bundeskanzlerin längst selbstverständlich. Im Rückblick auf die deutsche Geschichte ist das Frauenwahlrecht jedoch noch relativ jung.
Bei der Premiere vor 90 Jahren nahmen 17,7 Millionen das neue Recht wahr, ein Wert der in der jüngeren Gegenwart kaum noch erreicht wurde. 82 Prozent der Frauen bestimmten so mit über die erste deutsche Nationalversammlung. Die hohe Wahlbeteiligung beweist nach Ansicht der Grünen-Vorsitzenden Claudia Roth, "wie groß das Bedürfnis der Frauen war, endlich ihre Fähigkeiten einzubringen". Die Bundessprecherin der Bundesarbeitsgemeinschaft der kommunalen Frauenbüros und Gleichstellungsstellen, Christine Kronenberg, meint: "Das war der Tag, an dem das Eis gebrochen ist für die Frauen."
Jahrzehntelang hatten Bürgerinnen angeführt von Vorreiterinnen wie Hedwig Dohm und Anita Augspurg mutig und leidenschaftlich für ihr Stimmrecht gekämpft. Ihr Einsatz beeindruckte auch Deutschlands bekannteste Feministin Alice Schwarzer. "Und ich habe mir gesagt: Nie mehr, Alice, nie mehr wirst du aus Protest nicht wählen gehen!", schreibt die "Emma"-Herausgeberin in dem Vorwort zu ihrem Buch "Damenwahl".
Revolution der Frauenrechte
Während der Revolution im November 1918 im Übergang vom Kaiserreich zur Weimarer Republik, erreichten die häufig verspotteten Frauenrechtlerinnen endlich ihr Ziel. Der revolutionäre Rat der Volksbeauftragten veröffentlicht am 12. November in Berlin einen Aufruf an das deutsche Volk, in dem das allgemeine, gleiche, direkte und geheime Wahlrecht im Deutschen Reich proklamiert wird. 18 Tage später beschließt der Rat das Wahlgesetz, nach dem alle Frauen und Männer über 20 Jahre stimmberechtigt sind. Auch für Männer gilt erst seitdem ein nicht mehr nach Klassenzugehörigkeit gewichtetes Wahlrecht.
"Die Frauen selbst sahen diesen Tag gespalten", sagt die Historikerin Kerstin Wolff vom Archiv der deutschen Frauenbewegung in Kassel. "Wir stellen uns vor, alle schreien Hurra. Die Stimmen gab es auch, aber es fallen auch verhaltene Stimmen auf, denn das Frauenwahlrecht wurde vor dem Hintergrund des verlorenen Ersten Weltkrieges gewährt." Einige hätten sich erst an den Wechsel zur Demokratie gewöhnen müssen.
Immerhin sind nach der Wahl am 19. Januar 41 von 423 Abgeordneten der Nationalversammlung weiblich. Durch die Beteiligung der Frauen seien neue Themen - beispielsweise soziale - auf die Agenda gekommen, sagt Wolff. Die Politikerin Roth meint: "Erst mit dem Frauenwahlrecht lohnte es sich für die Parteien, Themen zu behandeln, die das Leben der Frauen betrafen."
Anteil der Frauen im Parlament ist gering
Von 1949 an liegt der Frauenanteil bei den Bundestagsabgeordneten bis in die 80er Jahre unter 10 Prozent. Inzwischen ist er bei einem knappen Drittel angekommen. Das erreichten die Frauen erst durch Quotenregelungen der Parteien. Die 32 Prozent Parlamentarierinnen hält Claudia Roth bei einem Frauenanteil von 52 Prozent in der Bevölkerung für nicht normal. Im europäischen Vergleich bleibt Deutschland damit zurück. Die Parlamente nordeuropäischer Länder wie Schweden (47 Prozent) und Finnland (41 Prozent) oder auch der Niederlande (41 Prozent) sind ausgeglichener besetzt.
Zu den 15 Mitgliedern der Bundesregierung gehören neben Kanzlerin Merkel Heidemarie Wieczorek-Zeul, Annette Schavan, Brigitte Zypries, Ulla Schmidt, Ursula von der Leyen und Ilse Aigner sechs Ministerinnen. "Wir sind in der Bundesregierung gut aufgestellt", sagt Christine Kronenberg. Gerade Merkel motiviert nach den Erfahrungen der Gleichstellungsbeauftragten der Stadt Köln junge Mädchen, sich politisch zu engagieren. Immer mehr Mädchen nennen als ihren Traumberuf Bundeskanzlerin, berichtet Kronenberg.
Kristina Puck, dpa
Quelle: ntv.de