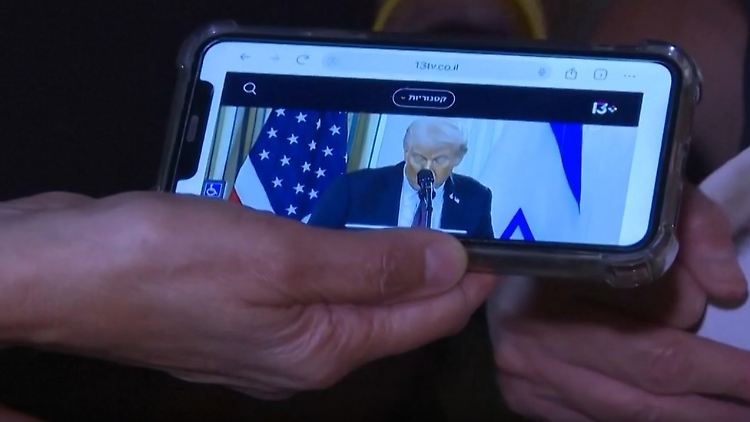Nicht immer aus der größten Partei Ausnahmen bei Regierungschefs
02.09.2009, 10:26 Uhr
Heinrich Hellwege kam in Niedersachsen 1955 an die Spitze einer Koalitionsregierung, obwohl seine Partei, die DP, nur die zweitstärkste von vier Partnern war.
(Foto: picture-alliance/ dpa)
Der Ministerpräsident eines Landes gehört fast immer der größten Partei einer Koalition an - aber es gab auch Ausnahmen. Die Verfassungen der Bundesländer treffen dazu keine Regelungen. In der Geschichte der Länder gibt es zwei ungewöhnliche Fälle, in denen der kleinere Koalitionspartner den Regierungschef stellte:
In Baden-Württemberg wurde der Liberale Reinhold Maier nach der Wahl 1952 Ministerpräsident einer Koalition seiner FDP/DVP mit der SPD und der Flüchtlingspartei GB/BHE. Im Landtag verfügten die Liberalen nur über 23 der 121 Mandate, die SPD hatte 38 Sitze, der GB/BHE 6. Hintergrund war, dass die SPD die Südwest-FDP/DVP - die gegen die CDU im Bund agierte - auf ihrem Kurs halten wollte. Einen Monat nach dem schlechten Abschneiden der FDP bei der Bundestagswahl 1953 trat Maier zurück. Nachfolger wurde Gebhard Müller (CDU), der eine Allparteien-Koalition ohne die Kommunisten führte.
In Niedersachsen kam Heinrich Hellwege nach der Wahl 1955 an die Spitze einer Koalitionsregierung, obwohl seine Deutsche Partei (DP) mit 19 von 159 Abgeordneten nur der zweitstärkste von vier Partnern war. Die CDU als größte Regierungspartei hatte 43 Sitze, der GB/BHE 17 und die FDP 12. DP und CDU bildeten damals eine gemeinsame Fraktion im Landtag. Vier Jahre später musste Hellwege seinem SPD-Vorgänger Hinrich Wilhelm Kopf wieder das Amt des Ministerpräsidenten überlassen.
Quelle: ntv.de, dpa