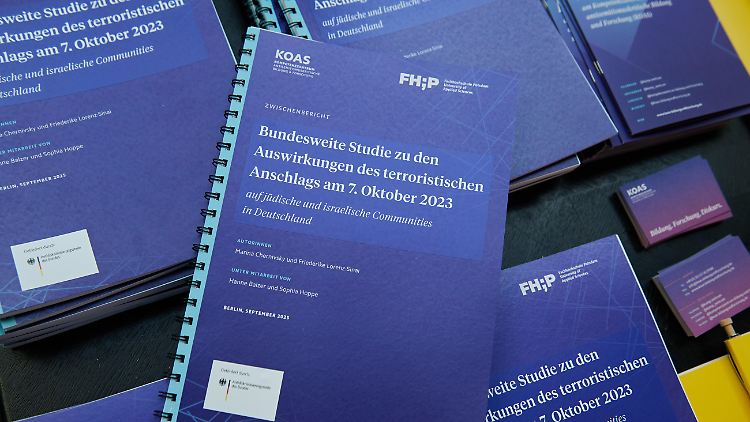"Denkwerkstatt" Halbe Erinnerung an den Krieg
15.11.2006, 11:30 UhrDer Krieg zeigt sein Gesicht: Unter einem dicken Kopfverband und Stahlhelm blickt ein Wehrmachtssoldat verzweifelt von der grauen Wand. Daneben ist auf einem Foto zusammengekrümmt ein gefallener Rotarmist zu sehen. "Wir müssen den Helden-Mythos wegkriegen, sagt Anita Wedel über die Bilder, die im Treppenaufgang der "Denkwerkstatt" Halbe hängen. Die 46-Jährige ist Jugendreferentin beim Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge und hat die Einrichtung mit aufgebaut. Dort wird seit eineinhalb Jahren versucht, sich mit der Geschichte der mörderischen Kesselschlacht am Ende des Zweiten Weltkriegs auseinander zu setzen.
Bei dem Gemetzel im April 1945 kamen schätzungsweise 60.000 Menschen ums Leben – Soldaten, Flüchtlinge, einheimische Zivilisten. Rund 24.000 von ihnen sind auf dem örtlichen Waldfriedhof, Deutschlands größter Kriegsgräberstätte bestattet. Seit Jahren veranstalten Neonazis deshalb in dem rund 3000 Einwohner zählenden Halbe (Dahme-Spreewald) zum Volkstrauertag im November ein so genanntes Heldengedenken – und knüpfen damit an die Hitler'sche Tradition an. Der nächste Aufmarsch ist für den 18. November geplant.
"Mit Helden hat das überhaupt nichts zu tun", macht Wedel klar. Statt in ihrer aussichtslosen Lage zu kapitulieren, befolgten die 9. Armee und Teile der 4. Panzerarmee den Befehl des "Führers", sich bis zuletzt gegen die sowjetische Übermacht zu wehren. Am Ende der Kämpfe stapelten sich in Halbes Straßen und Gärten die Leichen. Mit unzähligen Feldgräbern verwandelte sich der einstige Luftkurort im Süden Berlins in einen riesigen Friedhof. Vor allem dem unermüdlichen Einsatz des evangelischen Pastors Ernst Teichmann ist es zu verdanken, dass die Kriegstoten eine würdige Ruhestätte fanden.
In mehreren Stationen unternimmt die "Denkwerkstatt" den Versuch, das Unfassbare fassbar zu machen. Sie ist in Halbes ehemaliger Grundschule untergebracht, einem alten gelben Klinkerbau direkt neben der Kirche. Im Innern dominiert als Grundfarbe Grau - "um deutlich zu machen, dass Krieg nichts Freundliches hat", erklärt Wedel. Ein "Raum der Erinnerung" dokumentiert auf Tafeln die verschiedenen Opfer-Gruppen, die auf dem Friedhof Seite an Seite liegen: einfache Soldaten, Flüchtlinge und Zivilisten, Hitlerjugend, Volkssturm, Waffen-SS, Opfer der Wehrmachtsjustiz, sowjetische Zwangsarbeiter und Insassen des Speziallagers Ketschendorf.
Wenige Schritte weiter soll sich der Besucher in die Lage der damals in den Wäldern umherirrenden Menschen hineinversetzen: Dunkle Stoffbahnen sorgen für eine unheimliche Atmosphäre, während eine aufblitzende Stroboskop-Lampe Geschützfeuer imitiert. Ein "Raum der Fragen" enthält den Schriftverkehr des 1983 gestorbenen Pfarrers Teichmann mit Angehörigen von Kriegstoten, rund 3000 Briefe. Weitere Zimmer zeigen Dokumente von Zeitzeugen ("Wie lebt man mit dem Erlebten?") oder bieten Platz für Gespräche mit ihnen. Ein lichtdurchfluteter, freundlicher Raum schließlich lädt dazu ein, das Gesehene in Ruhe zu verarbeiten.
"Nicht belehren und nichts überstülpen", umreißt die frühere Geschichtslehrerin Wedel den pädagogischen Ansatz der Denkwerkstatt. Rund 1500 Besucher sind seit dem 29. April 2005 gekommen: Schüler, Jugendgruppen, Lehrer oder auch Bundeswehrsoldaten. Bis jetzt stellte das brandenburgische Innenministerium für die Einrichtung jährlich 25 000 Euro aus Lottomitteln bereit, das reicht Wedel zufolge jedoch nicht mehr aus. Angesichts des baufälligen Zustands des Gebäudes würden 2007 rund 100.000 Euro gebraucht. "Das ist das unterste Limit."
"Es geht so nicht mehr weiter. Man kann sich nicht von Fördertopf zu Fördertopf hangeln", stellt Wedel fest. Am liebsten würde sie die Denkwerkstatt – auch als Maßnahme gegen den Rechtsextremismus – zu einer Jugendbegegnungsstätte ausbauen und ist ihrem Traum vielleicht ein wenig näher gekommen: Das pädagogische Konzept liegt inzwischen bei Ministerpräsident Matthias Platzeck (SPD) zur Entscheidung.
Von Ronald Bahlburg, dpa
Quelle: ntv.de