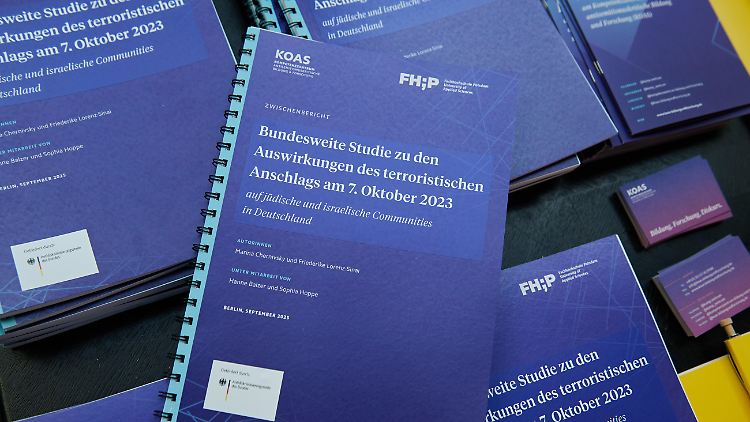"Virtuelles Wasser" Jedes Wasser zählt
20.08.2008, 08:52 UhrHinter alltäglichen Dingen wie Frühstücksei, Kaffeekochen und T-Shirt-Kauf verbirgt sich ein weit größerer Wasserverbrauch als auf den ersten Blick erkennbar ist. John Anthony Allan, Wasserexperte am Institut für Orientalische und Afrikanische Studien der Londoner Universität, hat für all jenes Wasser, das während der gesamten Erzeugung eines Produktes eingesetzt wird, in den 1990-er Jahren den Begriff "virtuelles Wasser" geprägt. Für seine Idee, mithilfe einer umfassenden Bilanz den Wasserverbrauch bei der Herstellung von Produkten zu veranschaulichen, wurde Allan 2008 mit dem hoch dotierten "Stockholmer Wasserpreis" ausgezeichnet.
Liegt der tägliche Wasserverbrauch für jeden Einwohner in Deutschland bei 130 Liter und damit im wassersparsamen Bereich, macht der virtuelle Wasserverbrauch 4.000 Liter pro Person und Tag aus. Virtuelles Wasser soll nach einer umfassenden Bilanz die tatsächlich verbrauchte Menge pro Produkt aufzeigen und folgerichtig den versteckten Verbrauch des Wassers im Alltag.
Experten fassen daher die Menge an sauberem Wasser zusammen, die zur Herstellung eines Produkts verbraucht, verdunstet oder verschmutzt wird. Dabei wird das Wasser, das zur Bewässerung der Rohstoffpflanzen benötigt wird, ebenso berücksichtigt wie das Kühlwasser der eingesetzten Maschinen.
Das meiste geht in die Nahrung
Generell verschlingt die Nahrungsmittelproduktion immense Mengen an Süßwasser für die Bewässerung der Landwirtschaft. 65 bis 70 Prozent des globalen Süßwasserverbrauchs werden der Landwirtschaft zugeführt, der verbleibende Rest von zwanzig Prozent wird durch Herstellung und Handel mit industriellen Gütern verbraucht. Mit der Bilanzierung virtuellen Wassers beschäftigt sich vor allem das Institute for Water Education der UNESCO, das unter anderem die Verbrauchsmengen virtuellen Wassers veröffentlicht.
Forscher versuchen die virtuellen Wasserströme zu erfassen, die durch den weltweiten Handel entstehen. Denn über den Umweg des "virtuellen Wassers" werden gigantische Wassermengen auf der Welt umverteilt. Wenn ein Land ein Gut, das mit hohem Wasserverbrauch produziert wurde, exportiert, dann fließt "virtuelles Wasser" ab. Aus ökonomischer Sicht könnte es sinnvoll sein, Produkte mit einem hohen Bedarf an Wasser, in wasserreichen Ländern zu produzieren und nur solche mit einem niedrigen Bedarf an Wasser in wasserarmen Ländern anzubauen, damit die natürliche Ressource Wasser so weit wie möglich geschont wird. Die Umsetzung solcher Vorstellungen ist jedoch mit Veränderungen verbunden, die nicht von heute auf morgen zu erreichen sein werden.
"Wasserfußabdruck"
Berücksichtigt man den Import und den Export von virtuellem Wasser und den täglichen Wasserverbrauch ergibt sich daraus der Wasserfußabdruck. Er kann für einzelne Personen, Unternehmen oder ganze Nationen berechnet werden. Abhängig vom Klima, dem Boden, den Anbaumethoden und der (Bewässerungs-)Technologie fallen die "Wasserfußabdrücke" von Nationen sehr unterschiedlich aus.
Vier wichtige Faktoren bestimmen die Größe des "Wasserfußabdrucks". Zum einen die Gesamtmenge des Konsums an Lebensmitteln und Industriegütern, hinzu kommt die Art des Konsums: Fleischprodukte gehen mit einem besonders hohen Wasser-Fußabdruck einher. Ein weiterer Faktor ist das Klima: In trockenen Ländern, etwa in Afrika, muss besonders viel bewässert werden. Entscheidend ist auch die Effizienz der Bewässerungstechnik: Wenn der landwirtschaftliche Ertrag pro eingesetzter Wassermenge gering ist, erhöht sich der Wasser-Fußabdruck. Neuere Bewässerungsanlagen können Wasser jedoch zielgenau dosieren, so dass nur sehr wenig Wasser verdunstet bzw. ungenutzt im Boden versickert.
Fleisch ändert die Dimension
Der Lebensstil prägt den Wasserbedarf. Im Minimum sind 1.000 Liter virtuelles Wasser nötig, um eine tägliche Überlebensration zu erzeugen, ein Vegetarier nimmt bei ausgewogener Kost schon 2.600 Liter virtuelles Wasser zu sich. Dagegen braucht es gigantische 5.000 Liter, wenn täglich Fleisch und Wurst auf den Teller kommen.
Wer importiertes Obst und Früchte aus den trockenen Südregionen kauft, verschärft dort zudem den Wettbewerb um das knappe Wasser. Umweltexperten machen inzwischen deutlich, dass der Verzicht auf ein Steak für die Wasserbilanz deutlich mehr bringt, als das Auffangen von Regenwasser. Wer bewusster einkauft und konsumiert (beispielsweise mehr regionale Produkte oder mehr Kleider aus Biobaumwolle), spart dort Wasser, wo es wirklich darauf ankommt - in den Regionen der Erde, wo Wasser mehr und mehr zu einer konfliktträchtigen Ressource wird.
Neue Art der Entwicklungshilfe
Wer auf seine Konsumgewohnheiten nicht verzichten will, könnte sich zumindest dafür einsetzen, dass die deutsche Entwicklungszusammenarbeit stärker als bislang in einen optimierten Wassereinsatz in der Dritten Welt, in den Schwellen- und Transformationsländern investiert. Dieses Gebot ergibt sich auch aus der Kommentierung der UN zum "Menschenrecht auf Wasser".
Dort heißt es sinngemäß, dass die wirtschaftlich entwickelten Länder eine besondere Verantwortung haben, in der Dritten Welt dem Menschenrecht auf Wasser zum Durchbruch zu verhelfen - beispielsweise über einen angepassten und gerechteren Welthandel und über die Entwicklungszusammenarbeit.
Quelle: ntv.de