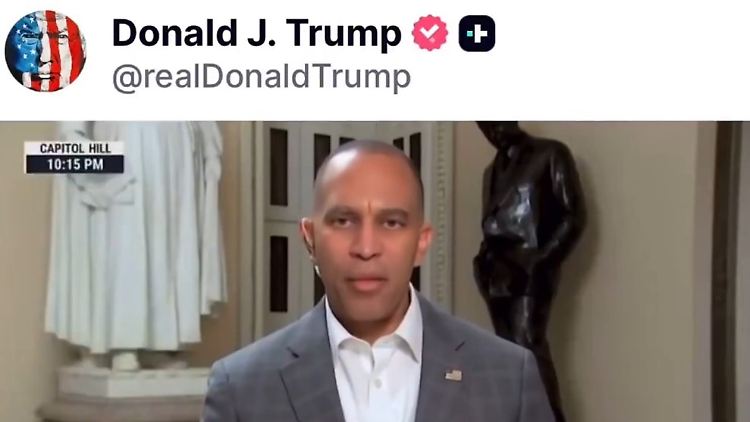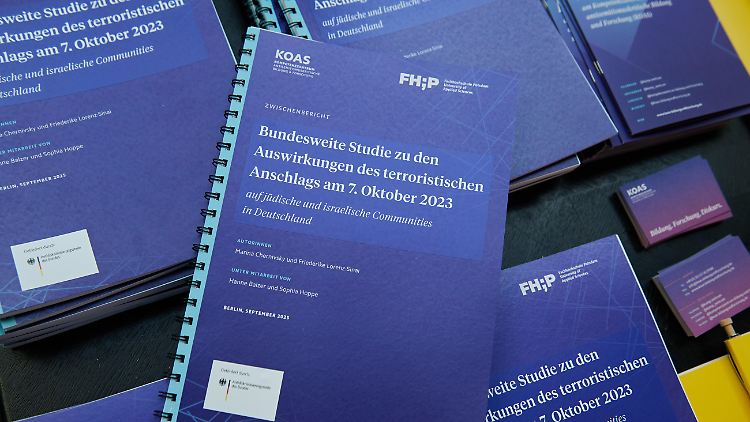Argentinien vor 26 Jahren Rückkehr zur Demokratie
30.10.2008, 08:33 Uhr
(Foto: picture-alliance/ dpa)
Am 30. Oktober 1983 kehrte Argentinien mit den ersten freien Wahlen nach sieben Jahren brutaler Militärherrschaft wieder zur Demokratie zurück. Dass Wahlsieger Ral Alfonsin von der Radikalen Bürgerunion UCR ein schweres Amt antrat, war wohl fast allen damals klar. Aber dass es so schwer werden würde, damit hätten wohl selbst die größten Pessimisten nicht gerechnet. Die unbelehrbaren Militärs machten dem hoch angesehenen Staatschef mit zahlreichen Aufständen das Leben schwer, die peronistischen Gewerkschaften zettelten einen Generalstreik nach dem anderen an, die von den Militärs geerbten horrenden Auslandsschulden wuchsen dem Land über den Kopf und die Inflation schoss auf mehr als 800 Prozent im Jahr in die Höhe.
25 Jahre später hat das Land große Fortschritte gemacht, die Diktaturvergangenheit wird entschieden aufgearbeitet und die Demokratie ist fester als in früheren Epochen des Landes verankert, sagt die deutsche Politologin und Argentinien-Expertin Ruth Fuchs. Die Entwicklung sei dabei nicht geradlinig, sondern in Wellen verlaufen, bei denen sich Phasen intensiver Auseinandersetzung mit der Vergangenheit mit Jahren der gesellschaftlichen Verdrängung des Themas abgelöst hätten.
Schreckliches Erbe
Dass der Anfang so schwer war, lag vor allem an dem schrecklichen Erbe der Militärdiktatur. Bis zu 30.000 Menschen hatten sie nach Schätzungen von Menschenrechtsorganisationen im Schatten ihrer krankhaften Kommunisten-Angst ermordet. Für Alfonsin ging es zunächst um Aufklärung und dann um Bestrafung der militärischen Führungsriege. Die Generäle aber waren nicht von einer starken Volksbewegung zurück in die Kasernen getrieben worden, sondern hatten sich durch den ein Jahr zuvor verlorenen Falkland-Krieg selbst ein Bein gestellt.
Während die Verurteilung der Junta-Mitglieder zu langjährigen Haftstrafen 1985 noch großen Beifall fand, verschärfte sich die Lage zunehmend, als die Justiz auch mittlere Dienstränge zu belangen begann. Bei denen handelte es sich oft um Falkland-Veteranen, die für die zurückliegenden Menschenrechtsverbrechen nicht gerade stehen wollten. Alfonsin wusste sich angesichts wiederholter Militärrebellionen schließlich gegen die mutig weiter ermittelnde Justiz nicht anders als durch eine Amnestie zu behelfen. Das Thema Diktaturverbrechen und Menschenrechte geriet damit ab 1986 immer mehr aus dem Blickfeld. Dazu trug auch die sich immer weiter verschlechternde Wirtschaftslage bei.
Schockierende Berichte
Während der 1990er Jahre unter dem konservativ-peronistischen Präsidenten Carlos Menem änderte sich daran zunächst nur wenig. Aber dann gerieten die Diktaturverbrechen im März 1995 schlagartig wieder in den Mittelpunkt der öffentlichen Diskussion. Auslöser waren die Aussagen des pensionierten Korvettenkapitäns Adolfo Francisco Scilingo. Er beschrieb die grausame Praxis der sogenannten "Todesflüge" der Diktaturzeit, bei denen die Opfer der Militärs in betäubtem Zustand aus Flugzeugen ins Meer geworfen wurden.
Die schockierenden Berichte Scilingos sollten für die Auseinandersetzung mit dem Erbe der Diktatur entscheidende Konsequenzen haben. "Sie lösten eine neue Welle öffentlicher Diskussionen über das Erbe der Diktatur und über das Schicksal der "Verschwundenen" aus", betont Fuchs. Dabei seien auch die Stellung des Militärs im Staat und die Qualität der Demokratie wieder in das Blickfeld der Öffentlichkeit gelangt. Es dauerte dann aber noch einige Jahre, bis unter dem Präsidenten Nstor Kirchner ab 2003 die Amnestie aufgehoben wurde, und die Justiz ihre Ermittlungsarbeit wieder aufnehmen konnte.
Inzwischen verzeichnet die argentinische Justiz nach Angaben von Fuchs die weltweit höchste Zahl anhängiger Verfahren wegen Menschenrechtsverbrechen aus der Zeit der Diktatur. Ende Juli 2008 ermittelte die Staatsanwaltschaft gegen 1088 Verdächtige: 403 von ihnen standen unter Anklage, 336 saßen in Untersuchungshaft. 28 frühere Schergen der Militärdiktatur waren bereits rechtskräftig verurteilt. Und auch während der schweren Wirtschafts- und Sozialkrise ab der Jahreswende 2001/2002 bestand nie die Gefahr, dass sich das Militär erneut zum "Retter des Vaterlandes" aufschwingen würde.
Quelle: ntv.de, Jan-Uwe Ronneburger, dpa