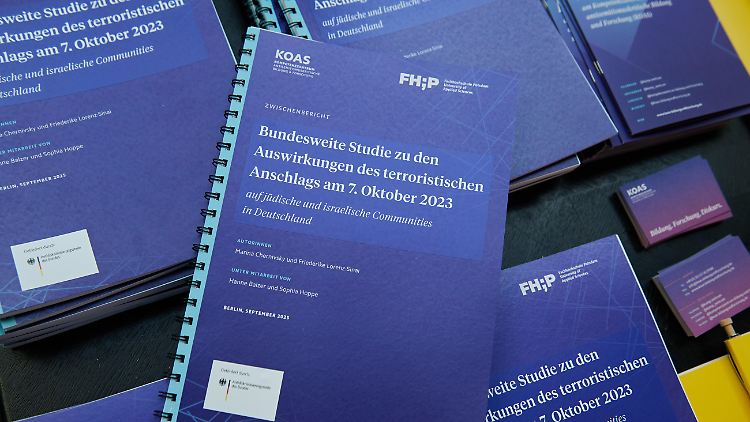Kein "jüdischer" Rembrandt Schluss mit dem Mythos
12.11.2006, 15:37 UhrJüdische Gelehrte und Rabbiner, jüdische Bräute, alte Juden mit Bart und junge Juden mit Käppchen und traurigen Augen: Diese Motive, so will es die Überlieferung seit Generationen, bevölkern in reicher Zahl die Bilderwelt Rembrandts. Das junge Malergenie aus Leiden sei 1632 sogar extra in das Amsterdamer Judenviertel gezogen, um seinen Lieblingsmotiven möglichst nah zu sein. Gründlich demontiert eine Ausstellung in Amsterdam jetzt den lieb gewonnenen Mythos des "jüdischen" Rembrandt, der seit rund 150 Jahren vom niederländischen Bürgertum ebenso wie von zahlreichen in- und ausländischen Kunsthistorikern, von Juden wie Nicht-Juden, als Markenzeichen der religiös-liberalen Niederlande hoch in Ehren gehalten geworden ist. "Die meisten der angeblichen Juden und Rabbiner sind nicht mal mehr echte Rembrandts", überraschen die Experten Mirjam Alexander und Edward van Voolen mit jüngsten Forschungsergebnissen zum Abschluss des Jubiläums-Ausstellungs-Reigens im 400. Geburtsjahr des Malers.
Mit rund 60 Exponaten aus internationalem Museumsbesitz, darunter das imposante Zentralwerk "Moses zerschmettert die Gesetzestafeln" aus Berlin, stellen die beiden Wissenschaftler im Jüdisch Historischen Museum seit dem Wochenende (bis 4. Februar) die kritische Frage, ob die schöne Fiktion von Rembrandt als dem Freund jüdischer Kultur und Religion weiter gültig sein kann. Von drei Dutzend Männerbildnissen, die die Museumswand zieren und ehedem als "jüdische" Porträts Rembrandts in Ehren gehalten wurden, sei gerade mal ein einziges Motiv übrig, das zweifelsfrei von der Hand des Meisters stammt und zugleich Porträt eines Juden sei. Bitterer Treppenwitz der Geschichte: Ausgerechnet auf dieses hervorragende, kleinformatige Bildnis des Arztes Ephraim Bueno (1647) hatte Hitler seine Hand gelegt, um es für das geplante Museum in Linz zu rauben.
Das weltbekannte Gemälde "Die jüdische Braut" von 1665/68, ganzer Stolz des benachbarten Rijksmuseums, erhielt seinen romantischen Titel erst im frühen 19. Jahrhundert, könnte eine mythologische Theaterszene ebenso darstellen wie ein Porträt des Rembrandt-Sohnes Titus mit seiner Braut, recherchierte Mirjam Alexander. Und Rembrandts Christus-Köpfe, deren Modelle der Maler angeblich gleich nebenan in der Synagoge fand, entstammen nachweislich einer exakten Beschreibung Jesu aus der Literatur der Rembrandt-Zeit. Weder finden sich Beweise für die behauptete Bekanntschaft des Malers mit dem bedeutenden jüdischen Philosophen Baruch Spinoza (1632-1677) noch für die viel beschworene enge Freundschaft mit dem gelehrten Rabbiner Menasseh ben Israel, der Rembrandt bei hebräischen Bildinschriften die Hand geführt haben soll: Kaum, so ist sich Kurator van Voolen sicher, hätte der Rabbi ihm den peinlichen Schreibfehler im Menetekel des hochdramatischen Gemäldes "Das Festmahl König Belsazars" (um 1635) durchgehen lassen.
In einer Mischung aus Romantizismus und einer Spur Rassismus haben Kunsthistoriker vor allem des 19. Jahrhundert das Klischee von "den Juden" in das Werk Rembrandts getragen. Erst durch die spätere Einwanderung orthodox Gläubiger erschienen Männer mit Schläfenlocken und Gebetskäppchen auf den Straßen der Stadt. Viel häufiger als Juden trugen zu Lebzeiten des Malers nämlich christliche Gelehrte und Theologen auffallend oft Bart oder Käppchen, wie zeitgenössische Kupferstiche beweisen. Rembrandts Nachbarschaft war nach Ausweis der Kataster damals noch keineswegs das typische Judenviertel Amsterdams, wie es bis zu den Deportationen durch die deutschen Besatzer vor gut 60 Jahren bestanden hat: Es war viel mehr das schicke Wohnquartier reicher - natürllch auch jüdischer -Kaufleute und aufsteigender Künstler.
Doch auch jüdische Kunstliebhaber und Sammler auf der Suche nach "ihrer" Kunst klammern sich nach den Erfahrungen der Amsterdamer Wissenschaftler bis heute nachhaltig an den Mythos des Juden-Freundes Rembrandt, dem die Schriftstellerin Anna Seghers 1924 ihre Doktorarbeit gewidmet hat und nach dem in Israel nicht wenige Straßen benannt worden sind. Am Ende von Rembrandt-Vorträgen, so berichtet van Voolen, werde er von ihnen oft besorgt gefragt: "Seien sie ehrlich, Rembrandt war doch jüdisch, oder?"
Von Gerd Korinthenberg, dpa
Quelle: ntv.de