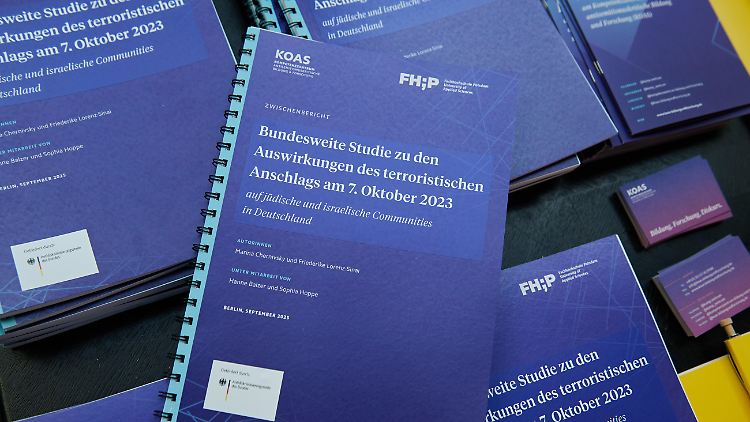Ständig im Einsatz Schweizer Lawinenforscher
30.01.2007, 12:39 UhrUm 17.00 Uhr entscheidet sich, wie die Chancen für den Skitag in den Bergen stehen: "Oberhalb von 2.500 m frischen Triebschnee beachten!" Wenn der Schweizer Lawinenwarnbericht in den Lagezentren eintrifft, löst er eine Welle von Entscheidungen aus: Pistenchefs und Lawinendienste beraten, ob Pisten geschlossen, Passstraßen gesperrt oder sogar ganze Orte evakuiert werden müssen.
Zehn Stunden zuvor steht Martin Kern im fahlen Morgenlicht mitten im Davoser Skigebiet in 2.540 Metern Höhe. Im Schnee steckt ein digitales Thermometer, es zeigt minus 2,1 Grad. Ein Messstab senkt sich in die Schneedecke: 21 Zentimeter. Der Wissenschaftler vom Eidgenössischen Institut für Schnee-und Lawinenforschung (SLF) misst die Schneehöhe und wiegt den Schnee. So lässt sich die Dichte und damit der Wasserwert des Schnees ermitteln. Doch das erledigt der Computer: Bis 7.30 Uhr müssen die Messdaten ins Tal geschickt werden.
Dort sitzen Martin Kerns Kollegen im Lawinenwarnraum vor ihren Monitoren. Schnee-und Wetterdaten aus den gesamten Schweizer Alpen sind auf einem großen Tisch ausgebreitet. Auch in schneearmen Wintern wie diesem sind die Frauen und Männer der Lawinenwarnung ständig im Einsatz: Anfang Januar sind bereits zwei Menschen in Schneemassen ums Leben gekommen. Im Kanton Bern ist ein Wanderer verschüttet worden, im Val Punt Ota in Graubünden wurde ein Skitourengeher von einer Lawine ins Tal gerissen. Er ertrank in einem Bach.
Die tödliche Gefahr hängt von vielen Faktoren ab: Vom Neuschnee, der in den vergangenen Tagen gefallen ist, oder vom Wind, der den Schnee über Bergkämme bläst und zu rutschigen Schneeansammlungen ablagert. Bei Neuschnee ist die Lawinengefahr meistens am größten. "Jede Schneedecke ist anders und bringt neue Probleme", erklärt Christine Pielmeier. Die 44-Jährige gehört zur Truppe der vier Lawinenwarner am SLF. Im Wettlauf mit der Zeit versuchen die Experten, aus vielen kleinen Puzzleteilchen ein Bild über die aktuelle Lage zusammenzusetzen.
Ein dichtes Netz von Beobachtern und automatischen Messstationen spannt sich über das Schweizer Alpengebiet. Mitarbeiter von Lawinen-und Sicherheitsdiensten geben täglich ihre Beobachtungen nach Davos durch. Wie häufig es geschneit hat, wie viel alter Schnee unter dem Neuschnee liegt, ob Lawinen gesprengt wurden oder die Schneedecke von selbst schon einmal abgerutscht ist, das wissen sie am besten. Dazu vermessen 70 Privatleute in einem Nebenjob den Schnee nach den gleichen Methoden wie Martin Kern am Messfeld des Instituts.
Kern hat inzwischen seine Tourenskier wieder angeschnallt und müht sich die 100 Höhenmeter hinauf zum Weißfluhjoch. Schweißbedeckt erreicht er das Institutsgebäude in 2662 Metern Höhe. Seit 1942 thront der graue Bau neben der Bergstation der Parsennbahn. Mittlerweile hat das SLF seinen Hauptsitz in Davos. Das Gebäude auf dem Weißfluhjoch wird noch genutzt, um Informationen für die Lawinenwarnung zu sammeln.
Alle paar Stunden stehen Messungen und Wetterbeobachtungen an. "Man schaut die Schneedecke wesentlich anders an, als wenn man nur im Tal unten sitzt", erklärt Paul Föhn. Dem 66-Jährigen sieht man das Leben in den Bergen an: Die Tage in der Höhenluft haben sein Gesicht gegerbt. 1972 kam er aufs Weißfluhjoch, wurde Leiter der Sektion Schnee und Lawinen. Mittlerweile ist er pensioniert.
Föhn ist ein Lawinenforscher der alten Schule. Er hat viel Zeit in den Hängen rund um das Joch verbracht, um Schneedecken im Profil zu untersuchen. Das hätte ihn einmal fast das Leben gekostet: Von einem Kollegen an einem Seil gesichert, hängt er in einem steilen Hang. Da löst sich die Schneedecke. Eine zwei Meter hohe weiße Wand rast auf ihn zu. Nur dank des Seils wird er nicht mitgerissen.
Paul Föhn hat Glück gehabt: Rund die Hälfte aller komplett verschütteten Personen überlebt nicht. Nach 15 Minuten sinkt die Lebenserwartung rapide, nach einer Stunde wird nur noch ein Fünftel der vom Schnee Begrabenen gerettet. Die meisten Lawinenopfer ersticken -wenn sie nicht schon vorher tödlich verletzt wurden: Schneebrettlawinen rasen oft mit mehr als 100 Stundenkilometern und der Gewalt einer Diesellok die Hänge hinunter.
Am frühen Nachmittag schnallt Martin Kern noch einmal die Skier an. Nach ein paar lockeren Schwüngen über die inzwischen von Skifahrern und Snowboardern bevölkerte Piste erreicht er das Versuchsfeld. Noch einmal wird nach der Schneehöhe gesehen, dann beginnt die Beobachtungstour durchs Skigebiet.
Im Sessellift lässt Kern seinen Blick über die Hänge oberhalb der Skipisten wandern. Links unter dem Schiahorn ist vor ein paar Tagen der Hang etwas abgerutscht, heute hat er gehalten. "Lawinengefahr mäßig" lautet Martin Kerns Einschätzung -Warnstufe zwei. Insgesamt gibt es fünf Warnstufen: Bei Warnstufe vier sind die Skigebiete nur noch teilweise geöffnet.
Die meisten Lawinenopfer sterben aber bei Warnstufe zwei oder drei, wenn sich trotz Lawinengefahr noch viele Wintersportler abseits gesicherter Pisten ins Gelände wagen. Dann war die Arbeit von Martin Kern und seinen Kollegen umsonst -denn der beste Lawinenwarnbericht nützt nichts, wenn sich die Skifahrer überschätzen.
Annika Graf, dpa
Informationen: Das aktuelle Lawinenbulletin kann im Internet abgerufen werden unter www.slf.ch (Tel von Deutschland: 0041/848 80 01 87). Das Institut kann freitags um 11.00 Uhr besichtigt werden (Flüelastraße 11, CH-7260 Davos Dorf).
Quelle: ntv.de