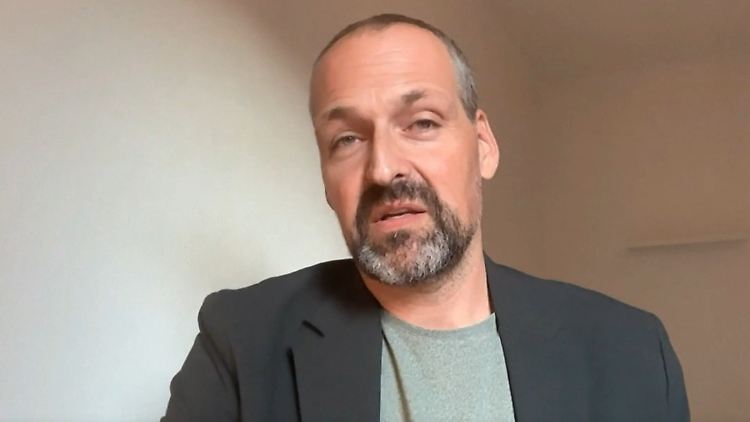Konjunkturpakete im Vergleich Steuern senken oder investieren?
08.12.2008, 14:55 UhrEin Patentrezept gegen die globale Wirtschaftskrise gibt es nicht. Weltweit streiten Politiker, ob Investitionen oder Steuersenkungen die richtige Antwort sind. Während amerikanische Konservative und europäische Liberale auf Steuersenkungen setzen, um den Konsum anzukurbeln, tendieren die Regierungen Deutschlands und Frankreichs sowie die US-Demokraten eher zu einer Mischung aus Investitionsprogrammen und Entlastungen. Als Faustregel gilt: In der Krise fordert jeder genau das, was er schon vorher für richtig gehalten hat.
Deutschland: "Kein Wettlauf um Milliarden"
Bundestag und Bundesrat haben Anfang Dezember ein Konjunkturpaket verabschiedet. Dabei stellen Bund und Länder in den nächsten zwei Jahren 32 Milliarden Euro zur Verfügung. Nach Angaben der Bundesregierung entspricht das Konjunkturprogramm etwa 1,3 Prozent des Bruttoinlandsproduktes.
Viele der beschlossenen Maßnahmen waren ohnehin geplant - etwa mehr Kindergeld und ein höherer Kinderfreibetrag sowie ab 2010 die steuerliche Absetzbarkeit von Kassenbeiträgen, die allein mit 9 Milliarden Euro zu Buche schlägt. Zieht man all dies ab, bleibt für den Bundeshaushalt eine Belastung in Höhe von 12 Milliarden Euro. Dazu gehören mehr Verkehrsinvestitionen, eine zeitlich befristete Kfz-Steuerbefreiung und eine bessere Absetzbarkeit von Handwerkerrechnungen.
Bei Neuwagenkäufen wird die Kfz-Steuer für ein Jahr ausgesetzt. Wer bis zum 30. Juni 2009 einen Neuwagen anmeldet, wird für ein Jahr von der Kfz-Steuer befreit. Beim Kauf schadstoffarmer Fahrzeuge der Schadstoffklassen Euro-V und Euro-VI gilt dies für zwei Jahre.
Bei Handwerkerrechnungen bis zu 6000 (statt bisher 3000) Euro können bis zu 20 Prozent von der Steuerschuld abgezogen werden. Die Mittel für das CO2-Programm zur Gebäudesanierung werden um 3 Milliarden Euro aufgestockt. Zur Unterstützung des Mittelstands stellt die KfW bis zu 15 Milliarden Euro an zusätzlichen Krediten bereit. Unternehmen, die im nächsten und übernächsten Jahr investieren, sollen diese Anschaffungen schneller abschreiben können. Zum Ausbau von Wasserwegen, Straßen und Schienen gibt der Bund 2009 und 2010 jeweils eine Milliarde Euro zusätzlich aus. Die Infrastrukturprogramme der KfW für strukturschwache Kommunen werden um 3 Milliarden Euro aufgestockt. Um zu vermeiden, dass Unternehmen bei vorübergehendem Auftragsrückgang Mitarbeiter entlassen, wird die Bezugsdauer des Kurzarbeitergeldes von bisher 12 auf 18 Monate verlängert.
"Einen Wettlauf um Subventionen oder Milliarden werden wir nicht mitmachen", betont Bundeskanzlerin Angela Merkel. Am 5. Januar treffen sich die Spitzen der Koalition zu einer Bestandsaufnahme im Kanzleramt. Das Konjunkturpaket wird dann nur wenige Tage in Kraft sein. Daher gilt als unwahrscheinlich, dass bereits bei diesem Treffen ein zweites Paket beschlossen wird.
In Frankreich glaubt man, dass die Bundesregierung im Februar oder März ein zweites Konjunkturpaket auflegen wird. Frankreich werde dann ebenfalls nachlegen, meint der französische Wirtschaftswissenschaftler Jacques Attali.
Frankreich: "Wir müssen wagemutig und phantasievoll sein"
Für den französischen Präsidenten Nicolas Sarkozy ist ohnehin jede Krise eine Chance. "Frankreich arbeitet daran, Deutschland denkt darüber nach", stichelte er bei einem Treffen mit Merkel am 24. November in Paris. Nachdem der Bundesrat dem deutschen Konjunkturpaket zugestimmt hatte, trumpfte die Bundesregierung auf: Deutschland begrüße, dass nun auch Frankreich ein Konjunkturprogramm angekündigt habe, merkte Regierungssprecher Steg spitz an.
Die Kritik der französischen Regierung an der deutschen Zurückhaltung wird in Frankreich von den meisten Medien geteilt. Allerdings schrieb die französische Wirtschaftszeitung "La Tribune" wenige Tage vor dem Treffen zwischen Sarkozy und Merkel: "Europa spricht von der Ankurbelung, Deutschland handelt". Das Blatt argumentiert, in Deutschland wirkten Konjunkturprogramme nur begrenzt, weil die Bundesrepublik stark von der Exportnachfrage abhänge.
"Wir müssen ehrgeizig, wagemutig und phantasievoll sein", sagte Sarkozy am 4. Dezember, als er sein 26-Milliarden-Euro-Programm vorstellte. Jenseits der Rhetorik gibt es bislang keine gravierenden Unterschiede zwischen der französischen und der deutschen Reaktion auf die Wirtschaftskrise. Wie die Bundesregierung will man Infrastrukturprojekte vorziehen. Rund 10 Milliarden sollen für Schnellbahnen, Hochschulen, Straßen und den IT-Bereich ausgegeben werden. Wie in Deutschland werden Anreize für Autokäufer geschaffen: So wird die Verschrottungsprämie für Altautos von 300 auf 1000 Euro erhöht. Einig sind sich Frankreich und Deutschland, dass die Mehrwertsteuer nicht gesenkt werden soll. Zur Unterstützung der Baubranche kündigte der Präsident den Bau von zehntausenden Sozialwohnungen an.
Stärker als Deutschland setzt Sarkozy auf eine Stützung von Schlüsselindustrien: Wie für den Flugzeugbau werde Frankreich einen Fonds für die Autobranche von 300 Millionen Euro auflegen. Dazu steuere der Staat sofort 100 Millionen Euro bei. Die Nutznießer müssten aber zusagen, keine Produktion ins Ausland zu verlagern. Insgesamt will Frankreich mit dem Paket 110.000 Arbeitsplätze sichern. Rund 3,8 Millionen besonders einkommensschwache Haushalte bekommen im März eine Prämie in Höhe von 200 Euro.
Für die Umsetzung des Konjunkturprogramms gibt es einen eigenen Minister: Den Job übernimmt der bisherige Generalsekretär der Regierungspartei UMP, Patrick Devedjian. Der 64-Jährige ist einer der engsten Vertrauten des Präsidenten. Wie beim deutschen Konjunkturprogramm entsprechen die französischen Maßnahmen der Regierung zufolge etwa 1,3 Prozent des Bruttoinlandsproduktes.
Großbritannien: Milliarden für Steuersenkungen
Die britische Regierung verfolgt eine andere Strategie als Deutschland und Frankreich. Mit ihrem Konjunkturprogramm in Höhe von 20 Milliarden Pfund (23,7 Milliarden Euro) will sie vor allem eine Steuersenkung finanzieren. Als erstes großes EU-Land hat Großbritannien im Dezember die Mehrwertsteuer von 17,5 auf 15 Prozent gesenkt. Die Maßnahme ist auf 13 Monate begrenzt. Allein diese vorübergehende Steuersenkung kostet den Staat 12,5 Milliarden Pfund, umgerechnet 14,4 Milliarden Euro. Zudem sind Steuergeschenke vor allem für ärmere Bürger vorgesehen, aber auch Erleichterungen für Aktiengesellschaften, Kleinunternehmen und Hauseigentümer.
Ihre Steuergeschenke will die Regierung von Premierminister Gordon Brown über höhere Schulden und - nach der Wahl - über einen von 40 auf 45 Prozent erhöhten Spitzensatz bei der Einkommensteuer finanzieren. Außerdem soll es 2009 weiter Steuerbefreiungen für Dividendenabführungen ausländischer Tochterfirmen an ihre britischen Muttergesellschaften geben. Eine geplante Steuererhöhung für Kleinunternehmen hat die Regierung gestrichen.
Europäische Union: Deutschland soll zahlen
EU-Kommissionspräsident Jos Manuel Barroso präsentierte Ende November ein Konjunkturpaket im Unfang von rund 200 Milliarden Euro. Dieses Paket beruht allerdings ganz überwiegend auf den nationalen Anstrengungen der 27 Mitgliedstaaten: Sie sollen 170 Milliarden Euro beisteuern, der Rest kommt aus EU-Mitteln. Die Bundesregierung etwa will sich ihr Paket in Höhe von 31 Milliarden Euro anrechnen lassen; darüber hinaus will sie kein Geld beisteuern.
Von den 30 Milliarden Euro aus EU-Mitteln entfallen 15,6 Milliarden Euro auf die Europäische Investitionsbank (EIB) in Luxemburg und 14,4 Milliarden Euro auf das EU-Budget. Die EIB wird 4 Milliarden Euro Darlehen für die Entwicklung umweltfreundlicher Autos anbieten. Rund 5 Milliarden Euro sollen in schnelle Internetleitungen oder die Verbindung der oft noch national abgeschotteten Energiemärkte investiert werden.
Die EU-Staats- und Regierungschefs werden bei ihrem Gipfeltreffen am 11. und 12. Dezember in Brüssel über den EU-Rettungsplan beraten. Streit ist vorprogrammiert: "Jeder Vorschlag, der auf der europäischen Ebene vom EU-Präsidenten oder auch von Frankreich gemacht worden ist, läuft im Zweifelsfall darauf hinaus, dass die Deutschen zahlen", sagte Bundesfinanzminister Peer Steinbrück. Mit anderen Worten: Großbritannien und Frankreich machen Druck auf Deutschland, weil die Bundesrepublik im Gegensatz zu diesen beiden Ländern einen viel größeren Spielraum im Haushalt hat.
USA: Obama hat es eilig
Im Wahlkampf hatte der künftige Präsident Barack Obama eine Steuersenkung für die Mittelschicht versprochen. Von einer Sondersteuer auf die Milliarden-Gewinne der Ölmultis ist er bereits wieder abgerückt. Der Fokus der Debatte liegt mittlerweile auf den Investitionen.
Anfang Dezember kündigte Obama das größte Konjunkturprogramm seit Menschengedenken an. Eine genaue Summe ist bislang nicht bekannt, die Rede ist von 150 Milliarden bis zu einer Billion Dollar, die demokratische Präsidentin des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, hat eine Summe zwischen 400 und 500 Milliarden Dollar genannt. "Wir können uns auf kurze Sicht nicht um das Haushaltsdefizit sorgen. Wir müssen sicherstellen, dass das Konjunkturpaket groß genug ist, um die Wirtschaft wieder zum Laufen zu bringen", sagte Obama. Schon am Tag nach seiner Amtseinführung, am 21. Januar, soll das Finanzpaket im Kongress verabschiedet werden.
Investieren will Obama in die Infrastruktur des Landes. Mit der Modernisierung von Schulen und Krankenhäusern, mit Energiesparprojekten in öffentlichen Gebäuden sowie dem Ausbau der Breitband-Internet-Verkabelung will er 2,5 Millionen Arbeitsplätze schaffen oder bedrohte Arbeitsplätze retten. "Es wird schlechter, bevor es besser wird", betont Obama immer wieder. Berichten zufolge wollen die Demokraten die drei großen Autobauer des Landes mit staatlichen Krediten in Höhe von 25 Milliarden Dollar unterstützen. Das Geld soll ausschließlich für die Entwicklung energiesparender Autos verwendet werden.
Im Februar hatte der US-Kongress bereits ein Paket im Umfang von 168 Milliarden Dollar verabschiedet, das zum größten Teil aus Steuergeschenken für die Bürger bestand - im Frühjahr und Sommer wurden Steuer-Schecks von mehreren hundert Dollar an die Bürger verschickt. Allerdings hatte das nur vorübergehend zu vermehrten Ausgaben geführt; von Juli bis September gingen die Einzelhandelsumsätze in jedem Monat zurück.
Quelle: ntv.de, Zusammengestellt von Hubertus Volmer