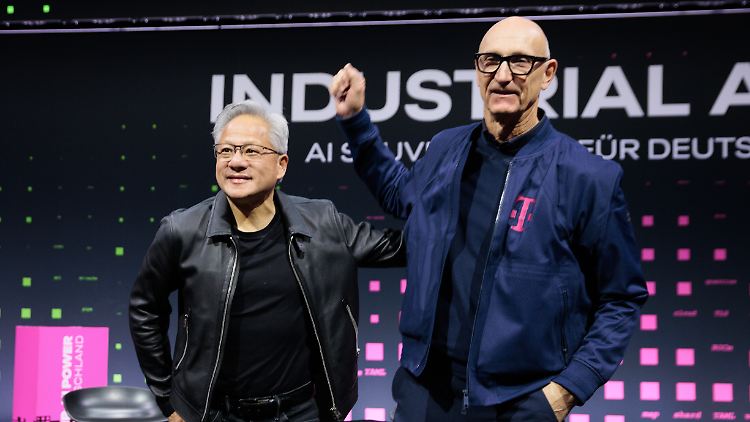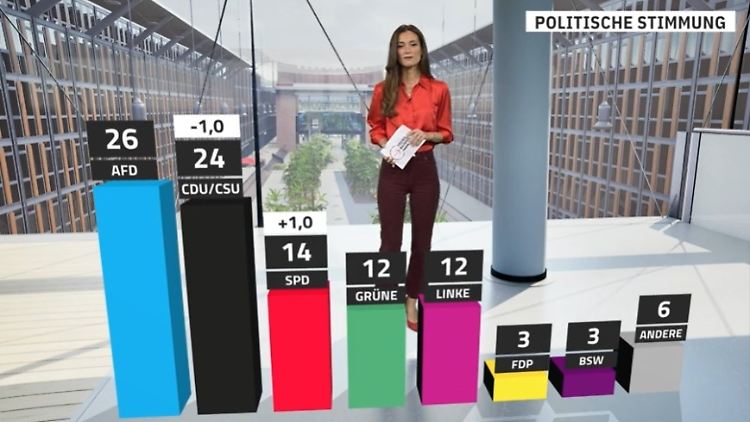n-tv.de Interview mit Zimmermann "Trauma bleibt lebenslang"
13.02.2009, 10:41 UhrDer Bundestag hat den Ausbau der Hilfe für traumatisierte Soldaten der Bundeswehr beschlossen. Unter anderem soll ein Forschungszentrum für die Krankheit Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) geschaffen werden. Zudem wurde nach andauernder Kritik die Einrichtung einer anonymen, zentralen Hotline für Betroffene beschlossen. "Das ist im Grunde nichts Neues", erklärt Peter Zimmermann im Interview mit n-tv.de. Bereits jetzt gebe es über eine Internetplattform die Möglichkeit, anonym Hilfe zu erhalten, sagt der Leiter der psychiatrischen Abteilung am Bundeswehrkrankenhaus in Berlin. Im n-tv.de Interview erklärt der Bundeswehrarzt, warum die Zahl der traumatisierten Soldaten nicht unbedingt gestiegen sein muss, woran eine traumatische Erkrankung zu erkennen ist und wie Angehörige von Betroffenen damit umgehen sollten.
n-tv.de: Der Bundestag hat beschlossen, die Betreuungsangebote für traumatisierte Bundeswehrsoldaten auszubauen. Zum einen, weil die Zahl der erkrankten Soldaten gestiegen sei, zum anderen, weil die bestehenden Angebote noch nicht ausreichten. Sind Ausbau und Verbesserung der Hilfe wirklich nötig?
Zimmermann: Das, was dort jetzt von der Politik an Vorschlägen gefordert wird, ist im Grunde nichts Neues. Vieles ist sowieso schon in der Planung oder Umsetzung. Ich sehe keinen Bedarf, das System von Grund auf zu reformieren, da unsere bestehenden Angebote nicht schlecht sind. Wir haben Behandlungsmöglichkeiten für traumatisierte Soldaten in den Bundeswehrkrankenhäusern; wir haben die psychosozialen Netzwerke, die als erste Ansprechpartner dienen. Aber diese Angebote mit den bereits in Angriff genommenen Veränderungen noch auszubauen, halte ich durchaus für sinnvoll.
Von welchen Veränderungen sprechen Sie?
Die Idee eines Forschungszentrums etwa, wie es bei Armeen anderer Länder bereits existiert, gibt es schon länger. Was dabei noch verhandelt werden muss, ist der Umfang und die Größe eines solchen Zentrums.
Was kann ein solches Zentrum für die Therapie traumatisierter Soldaten leisten?
Psychotraumatologie ist zwar kein neues Thema in der Forschung, sie wird seit 20 Jahren grundsätzlich und seit 10 Jahren intensiver beforscht. Allerdings gibt es in der Bundeswehr bisher nur Forschungen im begrenzten Ausmaß. Da viele Studien aus den USA kommen ist immer die Frage, ob die Ergebnisse, die dort herausgefunden wurden, auch für die Bundeswehr gelten. Zum zweiten kann man neben Therapiemöglichkeiten auch die Prävention erforschen.
Dass die Erforschung der Traumata in Deutschland erst jetzt intensiviert wird, hängt sicher doch damit zusammen, dass die Zahl der traumatisierten Soldaten ansteigt.
Das ist sicher ein Faktor. Aber eines muss man bei der Wahrnehmung der Anzahl der Fälle unterscheiden: Sicher ist nur, dass die Zahl der behandelten Fälle steigt. In der Statistik tauchen nur die Behandlungsfälle auf, die in den Bundeswehrkrankenhäusern aufgelaufen sind. Somit kann ein Anstieg bedeuten, dass die Zahl der traumatisierten Soldaten gestiegen ist; es kann aber auch bedeuten, dass die Zahl etwa gleich geblieben ist, sich aber jetzt mehr Soldaten trauen, sich zu melden. Wie viele Fälle es also tatsächlich in der Truppe gibt, und ob diese Zahlen auch gestiegen sind, das lässt sich nicht mit Sicherheit beurteilen. Klar ist nur, dass der therapeutische Bedarf steigt, weil es mehr Soldaten gibt, die eine Therapie machen wollen. Über die Dunkelziffer gibt es nämlich keine Schätzungen. Das könnte sicherlich ein solches Forschungsinstitut versuchen herauszufinden.
Ein Grund für den Beschluss im Bundestag war der Vorwurf, die Hilfsangebote für die Soldaten hätten zu hohe Hürden. Etwa, weil die Schwelle, zu einem Psychologen zu gehen, so hoch sei. Deshalb wurde die Einrichtung einer anonymen Hotline beschlossen. Sind die Hürden für die Soldaten zu hoch?
Wir haben bereits niedrigschwellige Angebote geschaffen. Dazu zählt das psychosoziale Netzwerk, bei denen sich Soldaten an Pfarrer, Sozialarbeiter, Truppenärzte oder Psychologen wenden können. Zum anderen haben Betroffene im Internet die Möglichkeit, über die Plattform "Angriff auf die Seele" mit uns anonym Kontakt aufzunehmen. Auf der Seite können Betroffene eine Frage in ein anonymisiertes Formular tippen, die dann hier bei mir auf dem Computer erscheint. Es schreiben dabei auch viele zivile Traumatisierte, nicht nur Bundeswehrsoldaten. Zudem melden sich auch Kameraden, ärztliche Betreuer und Angehörige, die nicht wissen, wie sie mit einem Traumatisierten umgehen sollen.
Wie viele Anfragen hatten Sie bereits über diese Internetseite?
Das Angebot besteht seit Mitte vergangenen Jahres, verstärkt genutzt wird es seit Oktober. In den vergangen drei bis vier Monaten hatten wir etwa 50 Anfragen über diesen Server. Und von diesen 50 Anfragen sind ungefähr 10 bis 20 Prozent in Therapie gegangen. Zudem werden wir demnächst eine Telefonhotline einrichten, da sind aber noch ein paar technische Details zu klären.
Wie merkt ein Soldat, ob er an traumatischen Erlebnissen erkrankt ist. Wie äußern sich die Traumata?
Das ist sehr vielgestaltig. Wenn jemand ein traumawertiges Erlebnis hat, heißt das noch lange nicht, dass er eine Posttraumatische Belastungsstörung (PTBD) entwickelt. Viele sind in der Zeit nach einem traumwertigen Erlebnis wie einem Attentat natürlich belastet. Sie schlafen schlecht, denken viel an die Ereignisse, sind unruhig oder weinen viel. Das ist aber noch keine psychische Erkrankung, sondern eine ganz normale Reaktion. Diese klingt bei den meisten innerhalb von ein paar Tagen oder Wochen spontan wieder ab. Wenn sie aber länger als vier Wochen besteht, könnte es sein, dass sich eine Krankheit entwickelt. Der Klassiker dabei ist die genannte PTBD, die sich durch drei wesentliche Symptome zeigt: Zum einen Erinnerungen, die sich aufdrängen und gegen die Sie auch nichts machen können. Die kommen aus heiterem Himmel, Sie sitzen etwa gerade beim Abendbrot, und plötzlich sind Sie wieder im Anschlagsgebiet. Oft auch szenisch, wie ein Flashback, mit Gerüchen, Gedanken, Gefühlen und Geräuschen. Ein solcher Film ist sehr belastend und sehr unangenehm. Oft haben die Betroffenen auch Albträume. Weil das alles viel Kraft kostet, ziehen sich sie sich dann von Verwandten und Bekannten zurück, werden eigenbrötlerischer und verschrobener. Viele bekommen dann zu hören: 'Du bist nicht mehr der alte.' Und drittens sind sie reizbarer, schreckhafter, nervöser und manchmal auch aggressiver.
Welche Krankheitsbilder gibt es noch neben der Posttraumatischen Belastungsstörung?
Der Traumatisierte kann plötzlich chronische Oberbauchschmerzen oder Sensibilitätsstörungen bekommen. Es gibt andere, die entwickeln Depressionen oder Angststörungen – die können plötzlich nicht mehr ihr Haus verlassen, weil sie draußen Angst haben, dass ihnen etwas passiert. Zudem gibt es viele Partnerschaftskonflikte, möglicherweise auch Ehescheidungen, Trennungen, die entsprechende depressive Reaktionen nach sich ziehen.
Welche Chancen haben Angehörige, etwas gegen diese Erkrankung zu unternehmen?
Angehörige sollten nicht als Therapeuten auftreten. Erstens haben sie keine Erfahrung, und zweitens möchte sich niemand von seiner Frau oder Mutter therapieren lassen. Aber sie können soziale Unterstützung leisten. Das heißt, wenn jemand der ein Trauma erlebt hat, ein soziales Umfeld hat, was ihn gut trägt und unterstützt, hat er eine deutlich geringer Wahrscheinlichkeit, eine Posttraumatische Belastungsstörung zu entwickeln, als jemand mit einem völlig kaputten sozialen Umfeld.
Was können Angehörige oder Freunde also konkret unternehmen?
Man sollte versuchen, denjenigen zum Reden zu ermuntern, aber man sollte ihm nichts entlocken oder entreißen wollen. Ein Angebot, aber kein Druck. Und dieses Angebot sollte enden, wenn der Betroffene durch Reden anfängt, sich in einen Flashback hineinzubegeben. Dann sollte der Angehörige diskret aber bestimmt unterbrechen. Zudem sollten Angehörige dem Betroffenen Nähe vermitteln, ohne ihm allzu sehr auf die Pelle zu rücken. Sie sollten ihm das Gefühl geben, ihn zu verstehen und zu tolerieren, dass er sich vorübergehend zurückzieht und reizbarer ist.
Wie gehen Sie in der Therapie der betroffenen Soldaten vor?
Wir führen eine Traumatherapie durch, die in drei Phasen abläuft. Die erste Phase ist die Stabilisierungsphase, die zweite ist die Traumakonfrontation und die dritte ist die Nachbetreuungsphase, die Re-Orientierungsphase. In der ersten Phase lernt der Betroffene Techniken, selber mit Überflutungen zurechtzukommen. Im nächsten Schritt werden die traumatischen Erinnerungen im therapeutischen Gespräch bearbeitet. Die Betroffenen müssen noch einmal die traumatische Situation erzählen, mit allen Gefühlen und Gedanken. Er erlebt sein Trauma noch einmal, aber mit fachkundiger Begleitung. Im Lauf der Sitzung stumpft sich dieses Erlebnis dann ab, es wirkt nicht mehr so dramatisch; die traumatische Erinnerung geht in eine normal über. Sie wird zwar nicht gelöscht – man vergisst die Bilder nie, aber sie belasten nicht mehr. In der dritten Neu-Orientierungsphase sprechen wir mit dem Betroffenen darüber, was das Trauma für sein Leben bedeutet. Wie ändert er jetzt vielleicht sein Leben, wie integriert er das Trauma in seine Lebensgeschichte und was lernt er daraus. Das ist der Abschluss.
Wie hoch sind die Heilungschancen einer solchen Therapie?
Generell kann man sagen, die Chancen sind sehr gut, man kann bei 80 bis 90 Prozent Besserung erreichen. Soweit, dass sie wieder ein vernünftiges Leben und eine Beziehung führen können. Das Trauma bleibt eine lebenslange Erfahrung, aber keine lebenslange Erkrankung, die man nie heilen kann.
Mit Peter Zimmermann sprach Till Schwarze.
Quelle: ntv.de