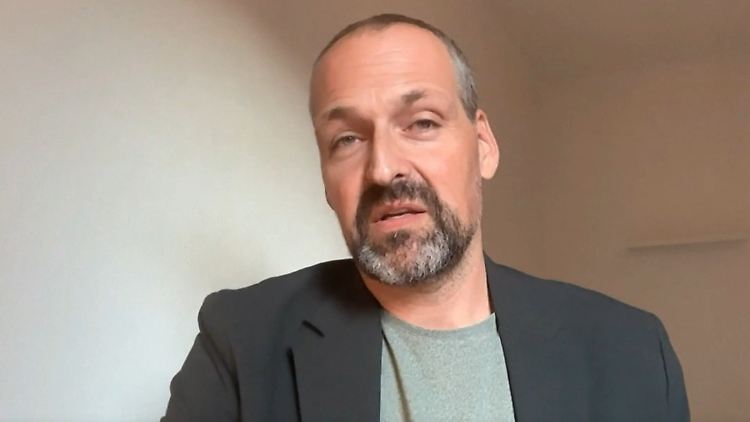Nicht verfassungskonform Vabanquespiel für Wähler
03.07.2008, 20:02 UhrDie Hamburger SPD-Wähler werden es kaum glauben können. Da sind sie bei der Bundestagswahl 2005 zur Urne geeilt, um ihre Partei - Agenda 2010 hin oder her - zu unterstützen. Und nun bekommen sie von höchstrichterlicher Stelle erklärt, dass sie es zu gut gemeint haben. Auf Seite 41 des Urteils, mit dem das Bundesverfassungsgericht Teile des Bundeswahlgesetzes für verfassungswidrig erklärte, heißt es: "Damit haben 19.500 Wähler der SPD in Hamburg dieser Partei durch ihre Stimme geschadet." Und folgerichtig hat Karlsruhe eine paradoxe Klausel, die Ja-Stimmen ins Gegenteil verkehren kann, gekippt.
Dass die Regelung jahrzehntelang unbeanstandet blieb, mag mit ihrer Kompliziertheit zu tun haben. Der Berliner Rechtsprofessor Hans Meyer, der die Wahlrechtsbeschwerde der findigen Kläger Wilko Zicht und Martin Fehndrich vertrat, hatte den verqueren Effekt mit dem Namen "negatives Stimmgewicht" schon 1997 gerügt. Vergeblich: Selbst das Bundesverfassungsgericht, das heute von einem "erheblichen Eingriff in die Wahlrechtsgleichheit" spricht, hatte die offenkundige Grundgesetzwidrigkeit damals nicht bemerkt.
Neu aufgerollt
Dass das Problem erneut auf dem Richtertisch landete, hat mit einer Nachwahl zu tun, die bei der Bundestagswahl 2005 wegen des Todes einer NPD-Direktkandidatin in Dresden notwendig wurde. Weil das übrige Ergebnis bereits bekannt war, konnte die Union ihren Anhängern vorrechnen, dass sie zwar ihre Erst-, aber bitte nicht zu zahlreich ihre Zweitstimme für sie abgeben sollten. Denn wäre die Union über einer Marke von gut 41.000 Stimmen gelandet, hätte sie bundesweit einen Sitz eingebüßt.
Auslöser der wundersamen Verwandlung von Plus in Minus sind die Überhangmandate, ein in Karlsruhe altbekanntes Problem, das das Gericht schon mehrfach beschäftigt hat. Überhangmandate entstehen, wenn eine Partei in einem Land mehr Direktmandate erringt, als ihr nach dem Verhältnis der Zweitstimmen zustehen. Die Partei darf diese Mandate behalten. Das Phänomen hat Konjunktur: Nur 16 Überhangmandate waren in den ersten vier Jahrzehnten der Bundesrepublik angefallen. Zwischen 1990 und 2005 gab es 54 davon - vorwiegend im Osten.
Rechenspiele und Listendreherei
Nun verfügte die Union vor der Nachwahl 2005 in Sachsen bereits einige Überhangmandate und hatte damit dort ihre Sitze sicher. Weil aber nach dem Zweitstimmenanteil berechnet wird, welche der Landeslisten bei der Mandatszuteilung zum Zuge kommt, konnte die Sachsen-CDU wenigstens den Unionisten in den anderen Ländern noch etwas Gutes tun: Sie musste nur ein schlechtes Ergebnis erzielen, damit eine andere Landesliste den Vorrang erhielt - womit bundesweit ein Sitz mehr herauskam.
Diese Klausel führt im Normalfall zu einem regelrechten "Lotterie-Effekt". Gerade in den Stadtstaaten und den östlichen Bundesländern, in denen regelmäßig Überhangmandate entstehen, weiß der Wähler nicht so recht, ob er seiner Partei wirklich etwas Gutes tut, wenn er ihr sein Kreuzchen schenkt.
Zwar hat der Zweite Senat - federführend Richter Rudolf Mellinghoff - die Vorschrift mit großer Eindeutigkeit als Verletzung der Gleichheit der Wahl beanstandet. Dennoch bleibt nicht nur die Wahl 2005 gültig, sondern auch der kommende Urnengang wird nach den verfassungswidrigen Regeln abgehalten. Grund: Mit einem kleinen Federstrich wird sich der Fehler nicht beheben lassen.
Wie es klappen könnte, wem es nützt
So lässt Karlsruhe dem Gesetzgeber zwar genügend Zeit für ein neues Gesetz bis Juni 2011 und gibt ihm darüber hinaus nur ein paar Stichworte an die Hand. Eine Neuregelung könne etwa "beim Entstehen von Überhangmandaten oder bei der Verrechnung von Direktmandaten mit den Zweitstimmenmandaten" ansetzen.
Womit die umstrittenen Überhangmandate, die das Gericht 1997 in einer äußerst knappen Entscheidung gerade noch für verfassungsgemäß erklärte, am Ende womöglich doch zur Disposition stehen. Würde der Verrechnungsmodus geändert, dann blieben sie zwar auf dem Papier erhalten. Doch ihr Effekt wäre weg, weil dann bundesweit entsprechend weniger Listenplätze vergeben würden. Der Proporz, der sich aus den Zweitstimmen errechnet, bliebe erhalten.
Leicht auszurechnen, wer das gut finden könnte: Die kleinen Parteien haben normalerweise nichts von Überhangmandaten - FDP, Grüne und Linke machten sich gleich nach dem Urteil dafür stark, dass es weniger davon gibt.
Wolfgang Janisch, dpa
Quelle: ntv.de