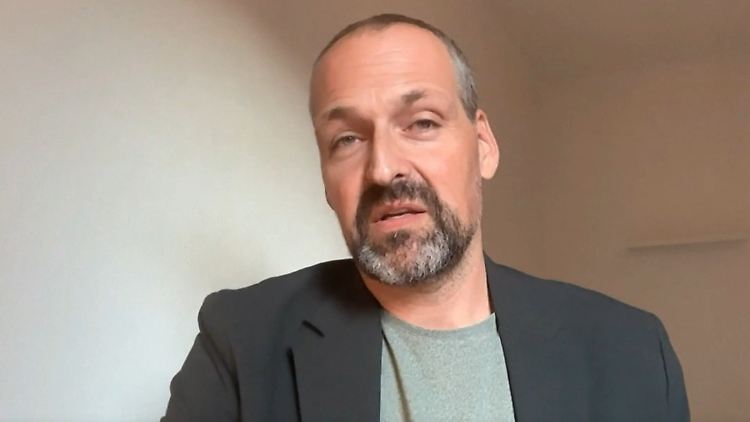"Politischer Terror" in Georgien Wahlbetrug befürchtet
21.05.2008, 08:06 UhrDie am Schwarzen Meer gelegene Kaukasusrepublik Georgien kommt nicht zur Ruhe. Seit Wochen überschattet der aufgeheizte Konflikt um die von Tiflis abtrünnige Region Abchasien nicht nur die internationalen Beziehungen, sondern auch den Wahlkampf. Zwölf Parteien und Blöcke treten zur vorgezogenen Parlamentswahl an. Die Opposition will mit der Abstimmung einen Sturz der Regierung von Präsident Michail Saakaschwili erreichen. Aber ihre Aussichten auf Erfolg sind gering. Wie bei der Präsidentenwahl im Januar befürchten die Regierungskritiker erneut massenhafte Wahlfälschungen.
Die Opposition wirft der Regierung vor, den Abchasien-Konflikt mit Russland nur zu benutzen, um von innenpolitischen Problemen wie Arbeitslosigkeit und Armut abzulenken. "Das politische Leben ist hochgradig polarisiert und instabil", sagt die unabhängige Politologin Russudan Tabukaschwili in Tiflis. Zwar hätten die rund 3,5 Millionen Berechtigten die Wahl, aber die Parteien würden eher von Personen als von trennscharfen politischen Positionen geprägt. Der Mangel an echten Programmen erschwert Wählern die Orientierung.
Opposition fehlt Führungsperson
Pauschalkritik an der Regierung und die Warnungen vor neuen Wahlmanipulationen bestimmen das Geschehen. Trotz wochenlanger Proteste gegen die Präsidentenwahl, einschließlich eines 17-tägigen Hungerstreiks und einer Erstürmung der Zentralen Wahlkommission, scheiterte die Opposition immer wieder, ihre Forderungen etwa nach einer Änderung des Wahlgesetzes durchzusetzen. Nach Meinung von Kommentatoren fehlt es den Gegnern von Saakaschwili vor allem an "richtigen Anführern". Dabei ist die Grundstimmung im Land weiterhin prowestlich mit dem von fast allen Gruppen vertretenen Ziel eines EU- und NATO-Beitritts.
Einige Umfragen sehen die Opposition vor einem Sieg im Rennen um die 150 Parlamentssitze. Doch vermuten sogar die regierungskritischen Parteien, dass sie sich gegenseitig die Stimmen wegnehmen könnten - zu zersplittert ist das Spektrum. Deshalb dürfte es trotz der von sieben auf fünf Prozent gesenkten Sperrklausel am Ende für eine Mehrheit der Saakaschwili-Gegner im Parlament wohl nicht reichen. Für den Fall neuer Wahlfälschungen hat der Führer des Blocks Vereinte Opposition, Lewan Gatschetschiladse, mit einem "revolutionären Sturz des Saakaschwili-Regimes" gedroht. Der "politische Terror" müsse ein Ende haben, sagt Gatschetschiladse, der bei der Präsidentenwahl im Januar Zweiter wurde.
Die regierende Präsidentenpartei Vereinte Nationale Bewegung, die um ihre Zweidrittelmehrheit fürchten muss, konnte im Wahlkampf nicht glänzen. Abgesehen von den Spannungen um Abchasien musste die Partei von Saakaschwili zahlreiche Rückschläge hinnehmen. Überraschend hatte etwa Parlamentschefin Nino Burdschanadse, die einst treue Weggefährtin Saakaschwilis, wegen innerparteilicher Querelen das Handtuch geworfen. Der Präsident musste Mitglieder seiner Partei, aber auch Polizei und Behörden zur Ordnung rufen, nachdem diese Druck auf Wähler - vor allem Schulpersonal - ausgeübt hatten. "Das Abhalten freier Wahlen ist eine Frage der Ehre", meinte er.
Staatspräsident unterliegt verführerischer Macht
Saakaschwili und seine Partei sind in großen Teilen der Bevölkerung tief in Ungnade gefallen, seit die Polizei im November Demonstrationen der Opposition brutal beendete. Viele Georgier berichten besorgt von autoritären Tendenzen in ihrer Heimat. Kritiker werfen Saakaschwili Unterdrückung Andersdenkender, Einschüchterungsversuche und Einflussnahme auf Medien vor. Der Held der Rosenrevolution von 2003 sei der "Arroganz der Macht" verfallen. "Saakaschwili kann keine Kritik ertragen", sagt die Schriftstellerin Naira Gelaschwili. "Wenn das Volk aber nie die eigene Stimme hört, dann kommt es zur Revolution oder mindestens zum Blutvergießen", meint die Leiterin des kulturpolitischen Kaukasus-Hauses in Tiflis.
Auch Wahlkampfbeobachter kritisieren, dass vor allem das Fernsehen überwiegend positiv und nicht neutral über Saakaschwilis Partei berichte. Zudem sei das Wahlgesetz so geändert worden, dass Regierungsbeamte und staatliche Ressourcen zu Wahlkampfzwecken eingesetzt werden dürfen, stellten Experten des Büros für Demokratie und Menschenrechte (ODIHR) der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) fest. Insgesamt sei die Führung aber bestrebt, die Wahlen demokratisch zu gestalten.
Von Ulf Mauder, dpa
Quelle: ntv.de