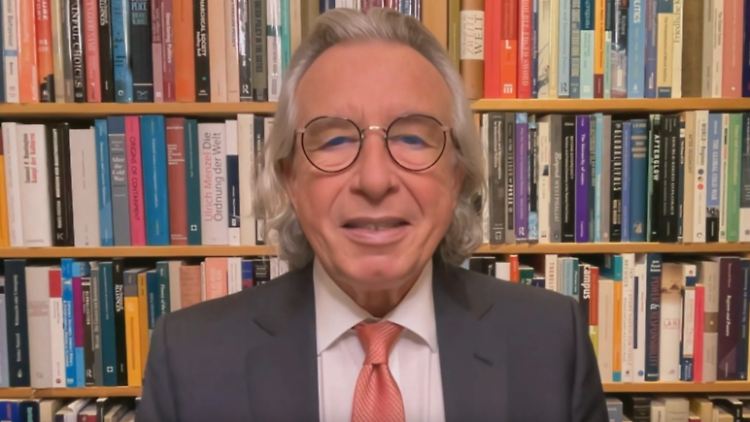US-Wahlnotizen III Wenn Supersuperdelegierte entscheiden
13.02.2008, 10:20 UhrDie Bedeutung einer Person lässt sich auch an der Zahl der Anrufe messen. Demnach ist eine spezielle Gruppe in den USA derzeit besonders bedeutend: die sogenannten Superdelegierten der Demokraten. Diese können sich derzeit vor Gesprächswünschen kaum retten. Donna Brazille, ehemalige Wahlkampfleiterin Al Gores, sagte jüngst der "Washington Post": "Jetzt hat mich sogar meine Nichte angerufen, um mich auf Barack Obama einzuschwören. Ich wusste gar nicht, was ich sagen sollte."
Von den 4049 stimmberechtigten Mitgliedern auf dem Parteitag der Demokraten Ende August in Denver, Colorado, zählen 796 zum illustren Kreis der Superdelegierten. Das sind unter anderem Kongressabgeordnete, Gouverneure, ehemalige Mandatsträger. Diese privilegierten Parteispitzen sind nicht an das Votum der Wähler in ihrem Staat gebunden, sondern können sich frei zwischen den Kandidaten entscheiden. Und genau das ist das Problem. Die Obama-Fraktion sagt: Die Superdelegierten müssen den Wunsch der Basis respektieren. Das Clinton-Lager hält dagegen: Die Unabhängigkeit der Superdelegierten müsse gewahrt bleiben. Und fährt das schöne Beispiel Massachusetts auf: Ted Kennedy und John Kerry müssten demnach, trotz gegenteiliger Bekundungen, Hillary wählen. Schließlich habe deren Heimatstaat für Clinton votiert.
Entscheidendes Votum
Analysten weisen darauf hin, dass das gemeine Wahlvolk den Spitzenkampf bei den Demokraten aller Voraussicht nach nicht mehr entscheiden kann. Der Grund ist: Die beiden Kontrahenten liegen zu dicht beieinander. Es kursieren Hochrechnungen, nach denen Barack Obama am Ende der Vorwahlsaison im Juni etwa 1650 Delegierte hinter sich versammeln kann. Hillary Clinton käme demnach auf rund 1580 Stimmen. Die Zahlen mögen variieren, doch die Botschaft ist unmissverständlich klar: Beide verfehlen auch nach Auszählung der letzten Vorwahlstimme die erforderliche Zielmarke von 2025 Stimmen. Ergo liegt das finale Votum bei den Superdelegierten.
Die demokratische Partei hat dieses Szenario selbst zu verantworten. Anfang der 80er Jahre waren die Superdelegierten installiert worden, um eine gewisse Kontrolle über den Vorwahlprozess zu erhalten. Zu groß war der Schock, als 1976 ein zuvor nahezu unbekannter Erdnussfarmer aus Georgia die Nominierung gegen den Widerstand des Parteiestablishments gewinnen konnte - und letztlich ins Weiße Haus einzog. Dieser Niemand hieß Jimmy Carter. Der konnte bei den Vorwahlen 1980 sogar die interne Gegenkandidatur Ted Kennedys abschmettern, um anschließend jedoch gegen Ronald Reagan zu verlieren. Diese Niederlage - nach Ansicht von Beobachtern auch eine Folge des selbstzerstörerischen Vorwahlprozesses.
Familienclan oder Halbheilige im Rücken
Im Jahre 2008 ist die Lage ebenfalls kompliziert. Die Partei hat zwei gute Kandidaten, und beide werden von Ikonen des eigenen Lagers unterstützt. Hillary Clinton kann sich auf die Regierungsgrößen ihres Mannes verlassen (und nicht zuletzt auf ihren Mann), Barack Obama auf parteiinterne Halbheilige wie die Kennedys. Howard Dean, offiziell der Vorsitzende der Demokraten, inoffiziell eher der Verwalter eines bedeutungslosen Amtes, hat die Kandidaten öffentlich gedrängt, sich möglichst schnell miteinander auf eine Lösung zu verständigen. Dieser Vorstoß habe für Heiterkeit gesorgt, hieß es unisono auf beiden Seiten.
Möglicherweise wird einem der Lager die gute Laune bald vergehen. Die Demokraten sind als Masochisten bekannt, nach acht Jahren Bush jedoch besessen, das Weiße Haus zu erobern. Also wird an Auswegsszenarien gebastelt, und das plausibelste geht so: Nach der zuletzt ungebremsten Siegesserie Barack Obamas - wie in Virginia, Maryland und Washington, DC - muss Clinton ihre Wählbarkeit endlich wieder unter Beweis stellen. Spätestens am 4. März. Sie selbst hat angekündigt, an diesem Mini-Super-Tuesday in den bevölkerungsreichen Staaten Texas und Ohio unbedingt gewinnen zu wollen. Also nimmt man sie beim Wort. Kann sich Obama in einem der beiden Staaten durchsetzen, dann ist die Wahl entschieden. Und zwar zugunsten Obamas.
Vorlieben verborgen
Die Superdelegierten müssten diese Variante unterstützen - und das gilt als sicher. Etwa die Hälfte der Spitzendemokraten hat bis heute keine Präferenz erkennen lassen - und geht mehrheitlich kühl kalkulierend vor. Sie schlägt sich auf die Seite des wahrscheinlichen Siegers, um für klare Verhältnisse zu sorgen. Dieses Verhalten hat weniger mit Opportunismus zu tun, sondern vielmehr mit einem gesunden Selbsterhaltungstrieb. Nur ein erfolgversprechender Kandidat ist für diese Delegierten auch ein guter Kandidat, schließlich haben viele von ihnen selbst im November eine Wahl zu bestehen.
Sollte Hillary stur bleiben und beispielsweise bis zur Abstimmung in Pennsylvania am 22. April warten wollen, müssen die, wie es heißt, Supersuperdelegierten ran. Parteigrößen wie Nancy Pelosi und Al Gore etwa. Diese hätten die Funktion, Hillary notfalls auch wenig diskret zur Aufgabe zu drängen. Ein Kommentator der "New York Times" schreibt dazu: Beide würden vermutlich mit einer gewissen Genugtuung das Haus Clinton endgültig zum Einsturz bringen.
Bleibt noch die Frage, was geschieht, wenn Hillary in Texas und Ohio siegt? Dann geht die Selbstzerfleischung munter weiter, möglicherweise bis zum Parteitag Ende August. John McCain hat eine echte Chance.
Erklärendes, Analysierendes, Kurioses, Überraschendes, Faszinierendes und Humorvolles: Christian Wilp, n-tv Washington-Korrespondent, beobachtet für n-tv.de den US-Wahlkampf 2008.
Quelle: ntv.de