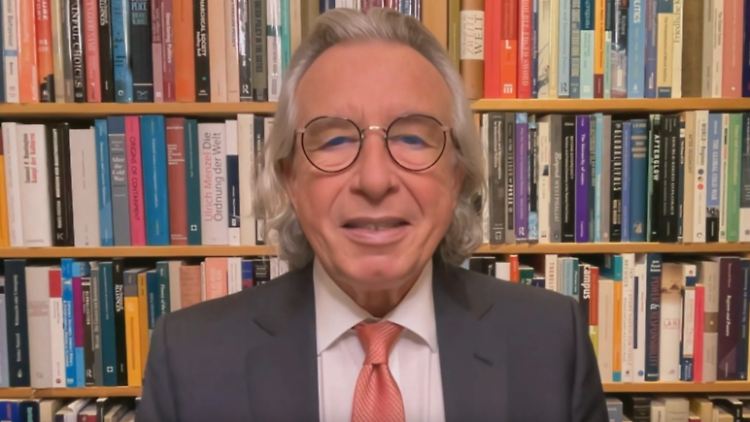Ein Land lähmt sich selbst Die USA im Dauerclinch
03.11.2010, 11:21 Uhr
In Indonesien ist Obama noch willkommen: Am Donnerstag verlässt der Präsident die USA für eine zehntägige Reise durch Asien.
(Foto: REUTERS)
Dass ein Präsident bei Halbzeitwahlen die Mehrheit im Kongress verliert, ist nichts Ungewöhnliches. Das macht es allerdings nicht besser: Die USA haben die Selbstblockade zum Prinzip erhoben.

Noch in der Wahlnacht telefonierte Obama mit John Boehner, dem neuen Präsidenten des Repräsentantenhauses.
(Foto: AP)
Der mächtigste Mann der Welt ist eine lahme Ente. In den nächsten zwei Jahren ist US-Präsident Barack Obama auf die Republikaner angewiesen, wenn er Gesetze durch den Kongress bekommen will. Doch den Republikanern steht der Sinn nicht nach Konsens, sondern nach Konfrontation.
Selbst mit einer Mehrheit im Kongress war es nicht weit her mit Obamas Macht. Bei der Gesundheitsreform kam er den Republikanern weit entgegen, ein Klimagesetz gibt es noch gar nicht. Größtes Versäumnis aus Sicht der Wähler ist die anhaltend hohe Arbeitslosigkeit: Vielen Amerikanern leuchtete offenbar nicht ein, dass die schwerste Wirtschaftskrise seit den 1930er Jahren nicht mit einem Federstrich im Oval Office beendet werden kann.
Dass ein Präsident bei Halbzeitwahlen die Mehrheit im Kongress verliert, ist nichts Ungewöhnliches. So ging es George W. Bush 2006 und Bill Clinton 1994. Für die Karriereplanung des Präsidenten muss das kein schlechtes Omen sein: 1996 wurde Clinton wiedergewählt; der Anführer der "republikanischen Revolution", Newt Gingrich, musste sich ein paar Jahre später aus der Politik zurückziehen, nachdem durchgesickert war, dass er ein außereheliches Verhältnis hatte, während er wegen der Lewinsky-Affäre die Amtsenthebung des Präsidenten betrieb.
Spaltung ist kaum überwindbar
Nicht nur bei Seitensprüngen gibt es in der amerikanischen Politik ein eklatantes Missverhältnis zwischen Rhetorik und Handeln. Penetrant wie in kaum einer anderen westlichen Demokratie beschwören beide Parteien die Notwendigkeit der "überparteilichen" Zusammenarbeit. Zugleich ist die gefühlte ideologische Kluft zwischen Demokraten und Republikanern kaum überwindbar: Zwischen Obama-Demokraten und Tea-Party-Republikanern gibt es weniger Sinn für Gemeinsamkeiten als zwischen FDP und Linkspartei in Deutschland.
Für Obama hat der Kampf um die Präsidentschaftswahlen 2012 begonnen. Er wird versuchen, seine Positionen besser zu erklären als bisher und er muss weiterhin darauf hoffen, dass seine gigantischen Krisenpakete mehr bringen, als bloß Schlimmeres zu verhindern. Blockierte Präsidenten weichen gern auf die Außenpolitik aus. So machte es Clinton, so wird es auch Obama machen. Wahlkampf und Diplomatie ist der Spielraum, den Obama noch hat.
Den Republikanern geht es ähnlich. Ihr zentrales Ziel ist zu verhindern, dass Obama in zwei Jahren wiedergewählt wird. Und sie wollen die Gesundheitsreform abschaffen, bevor die Wähler sich an deren Vorteile gewöhnen. Das jedoch wird nicht gelingen, solange Obama sein Veto einlegen kann.
Was kann der ohnmächtige Mann im Weißen Haus seinen Wählern noch bieten? Letztlich nur das Versprechen, Projekte eines republikanisch dominierten Kongresses zu stoppen, ein Bollwerk zu sein gegen die von der Tea-Party-Bewegung durchgeschüttelten Republikaner. In einem Land, das die Selbstblockade zum Prinzip erhoben hat, mag das für eine Wiederwahl, für die Verlängerung der eigenen politischen Karriere reichen. Für das Land selbst ist es zu wenig.
Quelle: ntv.de