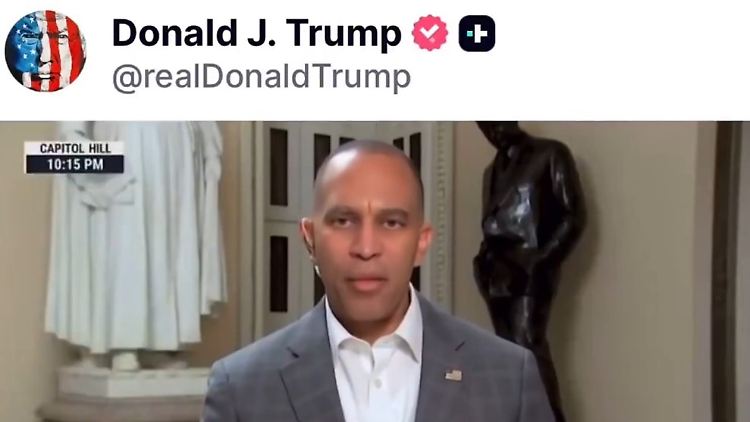Zwischenruf Größte Freude oder größte Sorge?
19.04.2010, 14:30 UhrMit größter Freude wurde 2005 verkündet, dass "wir einen Papst" hätten. Jetzt herrscht vielerorts höchste Besorgnis: Benedikt XVI. kann die in ihn gesetzten Hoffnungen nicht erfüllen.
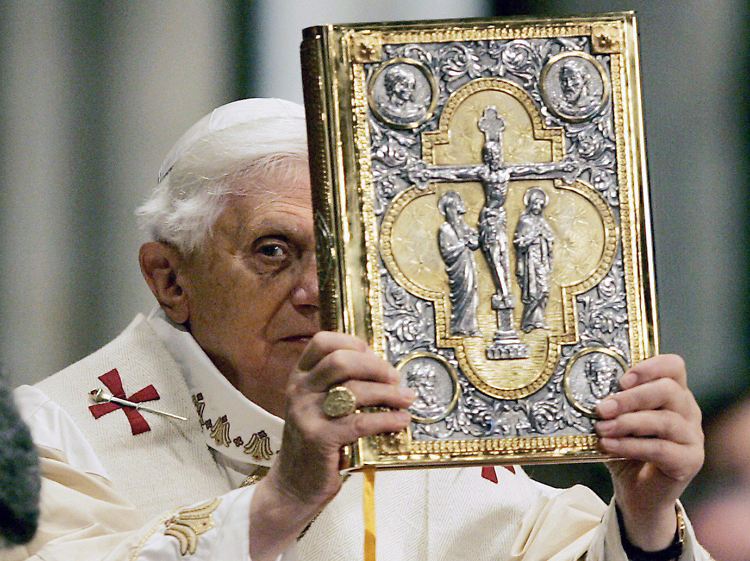
Ein Gefangener seiner selbst gezogenen Grenzen: Papst Benedikt XVI.
(Foto: dpa)
Als heute vor fünf Jahren der Ruf "Habemus papam" über die Piazza di San Pietro erschallte, reichten Reaktionen von überschwänglicher Euphorie über hoffnungsvolle Erwartung bis zu deutlicher Skepsis. So wenig wie "wir Papst" waren, so wenig war klar, wohin der Pontifex Maximus gehen würde. Die damals auch an dieser Stelle aufgekommene Hoffnung, ein Papst könne nicht wie ein Präfekt der Glaubenskongregation agieren, haben sich nicht bewahrheitet.
Sicher: In seiner Enzyklika "Caritas in Veritate" hat er sich ausdrücklich auf die 1967 schier revolutionäre wirkende Botschaft "Populorum Progressio" von Paul VI. bezogen: "Caritas in veritate in re sociali", die Wahrheit der Liebe Christi muss in der Gesellschaft verkündet werden. In der im vergangenen Jahr veröffentlichten Enzyklika unterzog er die verheerenden Auswirkungen der Globalisierung einer scharfen Kritik.
Doch Benedictus PP. XVI bleibt Gefangener seiner selbst gezogenen Grenzen. Er hat erkannt, dass die Welt kaum den Evangelien entspricht, doch er verharrt in der Feststellung dieser Tatsache. Sein Vorgänger Johannes Paul II. hatte sich das Ziel gestellt, den Staatssozialismus zu beseitigen. Er hat es geschafft. Was will Joseph Alois Ratzinger beseitigen? Während seines Pontifikats ist die römisch-katholische Kirche in ihre tiefste Krise seit Jahrzehnten geraten. Statt sich auf die frischen Kräfte des römischen Katholizismus zu stützen, versucht Benedikt XVI. seine rückwärtsgewandten Teile zu gewinnen.
Rückschritte im Dialog
Der Umgang mit der Pius-Bruderschaft spricht Bände. Er ließ die Tridentinische Messe wieder zu, die im 16. Jahrhundert Teil der Gegenreformation war. Als Benedikt die Karfreitagsfürbitte zur Bekehrung der Juden 2008 in einer neuen Übersetzung vorstellte, ging er weit hinter Karol Wojty?a zurück, der sich wie kein anderer auf dem Stuhl Petri um den Dialog mit der jüdischen Glaubensgemeinschaft eingesetzt hatte. Der Auftritt in Regensburg fügte dem Dialog mit dem Islam schweren Schaden zu. Die Ökumene ist nicht vorangekommen: Im Gegenteil. 2007 sprach der Papst den Protestanten das Recht ab, eine "richtige Kirche" zu sein. Der Dialog mit der Orthodoxie dümpelt vor sich hin, woran allerdings auch das Moskauer Patriarchat ein gerüttelt Maß Schuld trägt. Die Sonderregelungen für übertrittswillige verheiratete anglikanische Priester belastet das Verhältnis zur "Church of England". Wenn aber anglikanische Geistliche wie auch Priester der mit Rom unierten Ukrainischen Griechisch-Katholischen Kirche mit ihren immerhin fünf Millionen Gläubigen verheiratet sein dürfen, warum hebt der Papst den Zölibat nicht auf?
Der ambivalente Umgang mit den Missbrauchsfällen ist das – vorerst (?) – letzte Glied einer Kette, mit der der Heilige Vater seine Kirche fesselt. Aus dem Papst der Hoffnung ist endgültig ein Übergangspapst geworden. Mit "gaudium magnum" wurde am 19. April 2005 verkündet, dass "wir einen Papst" hätten. Die größte Freude ist vielerorts "cura maxima", höchster Besorgnis gewichen.

Manfred Bleskin kommentiert seit 1993 für n-tv das politische Geschehen. Er war zudem Gastgeber und Moderator verschiedener Sendungen. Seit 2008 ist Bleskin Redaktionsmitglied in unserem Hauptstadtstudio in Berlin.
Quelle: ntv.de