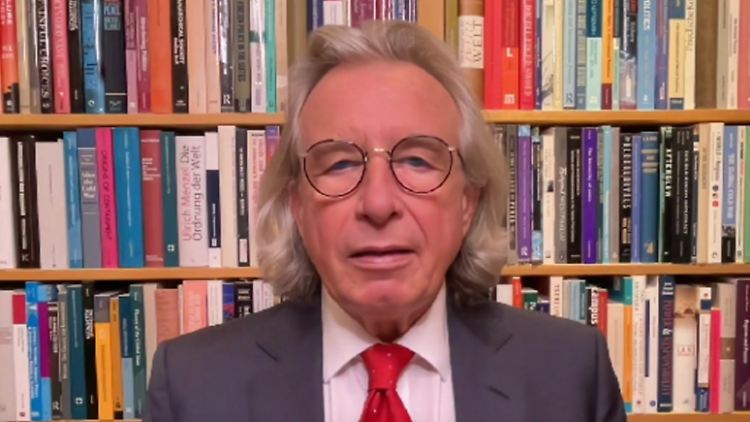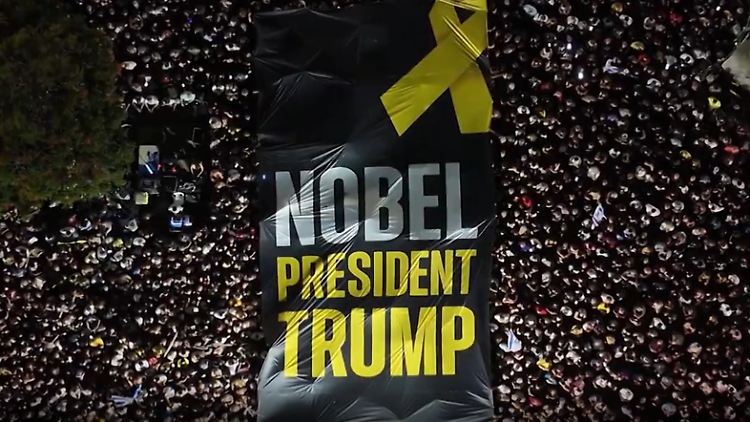Zwischenruf Putin: Gummiknüppel oder Steuerknüppel?
07.05.2012, 17:02 Uhr
Die "Wolgatreidler" von Ilja Repin. Die sozialen Probleme in Russland erinnern manchen heute wieder an das Bild der zerlumpten Arbeiter aus dem 19. Jahrhundert, das zurzeit in der Kunstsammlung Chemnitz zu sehen ist (hier mit Generaldirektorin Ingrid Mössinger).
(Foto: picture alliance / dpa)
Russlands alter und neuer Präsident Putin will der postsowjetischen Ära seines Landes endgültig seinen Stempel aufdrücken. Mit Polizeigewalt, sozialer Schieflage und zurückgebliebener Industrie wird das kaum gehen.
Wohl oder übel - die Welt wird sich daran gewöhnen müssen, dass der erste Mann Russlands für die nächsten zwölf Jahre Wladimir Wladimirowitsch Putin heißt. Mit Tricks könnte es sogar noch länger dauern. Der einstige KGB-Offizier hat die Mehrheit der Bevölkerung der Russischen Föderation hinter sich. Er hätte sie auch ohne die Wahlmanipulationen erreicht. Doch es mussten 64 Prozent statt der vermuteten 53 Prozent sein. Das ist der unselige Teil des sowjetischen Erbes: je mehr, desto besser.
Dass Putins Demokratieverständnis so rein gar nichts mit dem Lupenetikett seines Freundes Gerhard Schröder zu tun hat, ist bekannt. Gleichwohl zeigt die jüngst vereinfachte Prozedur bei der Zulassung neuer Parteien, dass auch der Erfinder der "gelenkten Demokratie" lernfähig ist. Mit der daraus folgenden Aufsplitterung der Parteienlandschaft ist aber auch das Kalkül verbunden, die eigenen Machtpositionen zu stärken. Bislang haben sich knapp 90 Gruppen als Partei registrieren lassen. Sollte die jetzt von Amtsvorgänger Dimitri Medwedew geführte Kreml-Partei "Einiges Russland" weiter an Einfluss verlieren, hält Putin mit der von ihm geschaffenen Gesamtrussischen Volksfront eine Alternative bereit.
Antiquierte Brutalität
Die Brutalität, mit der die Sicherheitskräfte bei der antiquiert-pompösen Amtseinführung gegen Demonstranten vorgingen, verheißt nichts Gutes. Die Polizeiknüppel auf den Rücken der Protestierenden sind Zeichen von Schwäche. Doch man sollte sich nicht täuschen: Die Proteste bleiben im Westlichen auf die Metropolen Moskau und Sankt Petersburg beschränkt. Im weiten Land herrscht weitgehend Ruhe. Das kann sich ändern, wenn die Pläne zur schrittweisen Anhebung des Rentenalters umgesetzt werden. Schon jetzt liegen viele Renten unter dem Existenzminimum.
Auch sonst bleibt genügend sozialer Sprengstoff: Die Schere zwischen Superreich und Bettelarm öffnet sich weiter. Die statistisch erfasste Arbeitslosigkeit ist gesunken. Doch die Realeinkommen halten mit der Preisentwicklung auf dem Wohnungsmarkt und bei den Dienstleistungen nicht mit. Mängel im Gesundheits- und Schulwesen kommen hinzu. Putin muss zwangsläufig einen Teil der durch Energieausfuhren erzielten Einnahmen zur Verbesserung der sozialen Lage in der Provinz einsetzen.
Russland ist technologisch zurückgeblieben
Entscheidend für Russlands Rolle als Großmacht wird sein, den Gummiknüppel durch den Steuerknüppel an modernen Produktionsanlagen zu ersetzen. Dazu muss das noch unter Medwedew in Angriff genommene Hochtechnologieprogramm verwirklicht werden. Bislang dösen die Arbeit in Skolkowo südwestlich von Moskau eher vor sich hin. Die Wirtschaft muss auf eine industrielle, hochtechnologische Grundlage gestellt werden. Selbst in so traditionellen Bereichen wie der Herstellung von Traktoren ist das Land zurückgeblieben. Die Rohstoffausfuhren mögen heute noch ausreichen - mit der Ausfuhrstruktur eines Entwicklungslandes lässt sich auf Dauer jedoch kein Staat machen.
Am Tag der Amtseinführung strotzt Putin vor Selbstbewusstsein. Die Parade zum Tag des Sieges über Nazideutschland am 9. Mai wird dieses Selbstbewusstsein auch militärisch widerspiegeln. Falls der Präsident am Nato-Russland-Gipfel Ende Mai in Chicago teilnehmen sollte, werden die Atlantiker auf einen Mann treffen, welcher der postsowjetischen Ära Russlands endgültig seinen Stempel aufdrücken will. Bislang erinnert die jüngere Entwicklung zwischen Wladiwostok und Murmansk eher an Ilja Repins "Wolgatreidler". Vonnöten ist jedoch ein neuer Sputnik.
Manfred Bleskin kommentiert seit 1993 das politische Geschehen für n-tv. Er war zudem Gastgeber und Moderator verschiedener Sendungen. Seit 2008 ist er Redaktionsmitglied in unserem Hauptstadtstudio in Berlin.
Quelle: ntv.de