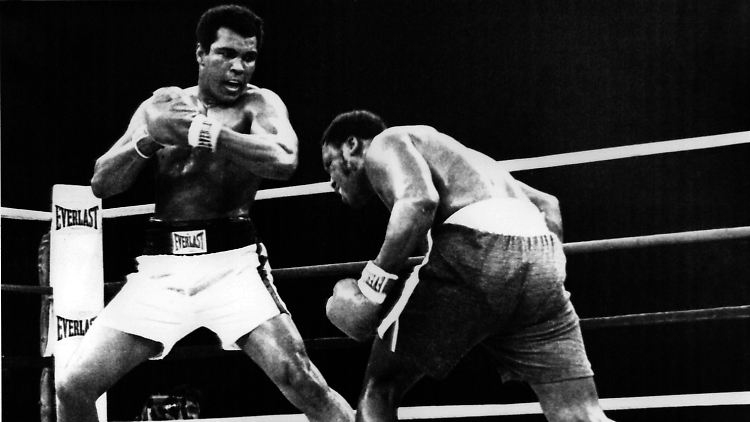"Gier tötet unsere Erwartungen" Wert der WM ist umstritten
03.03.2010, 16:22 UhrDie WM kostet Südafrika Milliarden. Was sie dem Land wirtschaftlich bringt, ist umstritten. Vor allem die WM-Aufschläge von Airlines und Hotels sorgen für Beunruhigung.
Südafrika bezeichnet sich stolz als den einzigen Industriestaat Afrikas, bis 2008 boomte mehr als 15 Jahre lang die Wirtschaft - und die Fußball-WM soll nach Vorstellungen der Regierung in Pretoria nach dem Konjunktur-Einbruch im Vorjahr noch einmal einen kräftigen Wachstumsschub bringen. Finanzminister Pravin Gordhan meint, der erwartete Anstieg des Bruttoinlandsproduktes 2010 um 2,3 Prozent werde zu mehr als einem Fünftel der WM zu verdanken sein.
Andere Experten wie die Analysten des Finanzdienstleisters Cadiz Securities sind skeptischer, verweisen auf Südkoreas enttäuschende Erfahrungen als WM-Gastgeber 2002 und sehen im Prestige-Objekt WM kaum einen größeren ökonomischen Wert. Die Zeitschrift "Financial Week" nannte die Milliarden-Ausgaben für Stadien "Verschwendung", das Geld hätte viel besser in Energie- und Bauprojekte angelegt werden sollen. Es gab auch schon gewalttätige Proteste in den Townships, bei denen Demonstranten die WM-Investitionen heftig kritisierten.
Drastische WM-Aufschläge
Südafrikas Regierung hat mit der Begründung der WM seit 2006 die für das Land enorme Summe von insgesamt 400 Milliarden Rand (etwa 36 Milliarden Euro) investiert, um vor allem mit Infrastruktur-Maßnahmen (Straßen, Energie, Flughäfen) für die WM gerüstet zu sein. Direkt für die WM - wie dem Neu- und Ausbau von Stadien, Sicherheitsmaßnahmen oder dem neuen Gautrain-Schnellzug von Johannesburg zum Flughafen, wurden rund 33 Milliarden Rand ausgegeben. Einnahmen während der WM, vor allem aber die langfristigen Auswirkungen für Südafrika als Investitionsstandort und Touristenziel, würden die für das Schwellenland enormen Ausgaben rechtfertigen, sagt die Regierung.
Allerdings werden die Einschätzungen nüchterner. So werden nicht mehr fast 500.000, sondern höchstens 350.000 Auslands-Gäste zur WM erwartet. Die Zurückhaltung in Europa, Amerika und Asien erklärt sich schon durch den hohen Aufwand für eine WM-Tour: Nicht nur die Anreise ins ferne Afrika ist teuer, Hotels und Airlines haben mit drastischen WM-Aufschlägen von bis zu 200 Prozent für saftige Preise und große Beunruhigung gesorgt. Die Tourismus-Branche, in der über eine Million Menschen tätig ist, sieht zunehmend skeptisch auf die WM. "Gier tötet unsere WM-Erwartungen", schrieb der Kolumnist Peter Delmar. "Wir stellen mit einem hässlichen Schock fest, dass sich nicht einmal die Deutschen, die reichsten Fußball-Fans der Welt, uns leisten können."
Zugleich Erste und Dritte Welt
Südafrika ist schon lange nicht mehr das Land, das vor allem mit Gold und Diamanten seinen Wohlstand - allerdings für eine Minderheit der Menschen - begründet. Inzwischen gibt es eine Automobilindustrie und High-Tech-Firmen, boomen Weinindustrie und Tourismus, genießen Universitäten und Forschungseinrichtungen hohes Ansehen. Der Rand ist stark, die Inflation niedrig - Südafrika steht nicht schlecht da im Vergleich zu anderen G20-Staaten. Allerdings liegt die offizielle und damit zu niedrig bezifferte Arbeitslosigkeitsrate bei 25 Prozent, die Schere zwischen Arm und Reich klafft in wenigen Staaten so krass auseinander wie in Südafrika. Wenige Kilometer von Yachthafen, Luxus-Hotels und faszinierenden Vergnügungsviertels an der Waterfront in Kapstadt liegen bitterarme Townships, in deren Hütten es keinen Strom und kein Wasser gibt - Südafrika ist zugleich Erste und Dritte Welt.
Auslandsinvestitionen und florierender Außenhandel belegen jedoch Südafrikas ungebrochene Stärke. Deutschland aber hat 2009 seine Top-Position als Handelspartner Nummer 1 an China abgeben müssen. Etwa 350 deutsche Unternehmen - darunter VW, Daimler und BMW - mit rund 68.000 Beschäftigten sind in Südafrika tätig, ihr Umsatz liegt bei fast 18 Milliarden Euro. Auch sie wollen mit Aktivitäten das WM-Großereignis zur Imagepflege nutzen. VW etwa mit internationalen Fußball-Turnieren von Kindern und Jugendlichen aus den Slums.
Quelle: ntv.de, Laszlo Trankovits, dpa