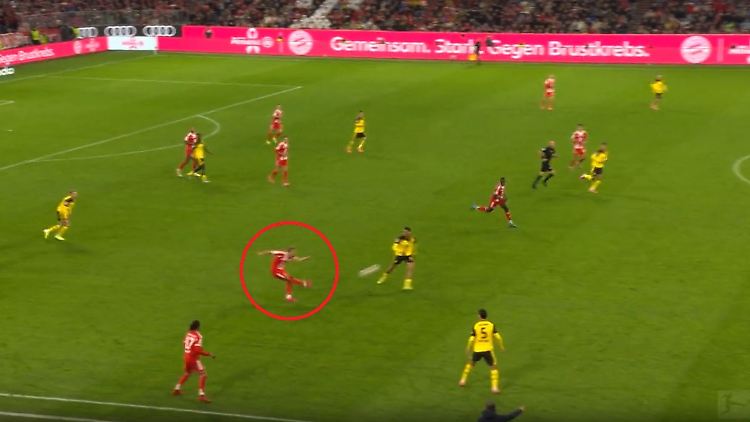Marianne Buggenhagen Integration bleibt ein Traum
27.09.2008, 07:00 UhrBei den Paralympics in Peking 2008 holt Marianne Buggenhagen mit einem Weltrekord im Diskuswerfen ihr neuntes paralympisches Gold. Mit dieser Leistung beendet die 55-jährige Ausnahme-Athletin ihre leistungssportliche Karriere. Mit n-tv.de spricht sie über ihre Eindrücke von Peking, positive und negative Entwicklungen im Behindertensport und ihre Pläne für die Zukunft.
n-tv.de: Frau Buggenhagen, mit welchem Gefühl sind Sie aus Peking wiedergekommen?
Marianne Buggenhagen: Natürlich bin ich mit einem Glücksgefühl zurückgekehrt, denn ich habe mir meinen Traum, mit einer Super-Leistung aufhören zu können, erfüllt.

Die elfjährige Li Yue verlor beim verheerenden Erdbeben in der Provinz Sichuan ihr linkes Bein. Bei der Eröffnung der Paralympics tanzt sie im Rollstuhl nur mit Oberkörper, Armen und Händen.
Sind Sie mit den Paralympics 2008 zufrieden?
Barcelona hat mir schon sehr gut gefallen, und Sydney hat mir gut gefallen, aber Peking hat alles getoppt - die Unterbringung, das Essen, das Transportwesen. Schon morgens um neun Uhr hatten wir über 60.000 Zuschauer. Das einzige Problem war der Smog, das war ganz schön schwierig, obwohl sie ja angeblich viel gemacht haben.
Welcher Athlet oder welche Athletin hat Sie in Peking am meisten beeindruckt?
Meine Zimmerkollegin, Frances (Herrmann). Sie ist 19 Jahre alt und gerade so in die Nationalmannschaft reingekommen: Wir haben vier Wochen dicht an dicht gewohnt und kamen unwahrscheinlich gut klar. Sie hat im Diskuswerfen eine Silbermedaille gewonnen, mit Weltrekord, und hatte vorher noch nie über 21 Meter geworfen. Sie hat eine super Leistung gebracht.
Trotz Weltrekord nur Silber: Die unterschiedlichen Kategorien, Klassifizierungen und Zusammenlegungen von Klassen sind für Laien schwierig zu verstehen. Gibt es da Pläne für mehr Transparenz?
Es ist in der Tat schwierig. Dabei wäre es eigentlich ganz leicht. Wenn man zum Beispiel in der CPer-Klasse (Cerebralparetiker) die Querschnittsgelähmten - egal ab welcher Höhe - in nur einer Klasse hätte und ein vernünftiges Punktesystem einführen würde, dann kann man doch klarmachen, dass jemand, der zum Beispiel vom Rumpf an beeinträchtigt ist, natürlich nicht so weit werfen kann wie jemand, der nur die Beine beeinträchtigt hat.
Ich zum Beispiel halte den Weltrekord in meiner Klasse - ich bin in der 55, das heißt ab Hüfte abwärts gelähmt - bei 27,80 Meter. Der Weltrekord in der Gruppe, die viel besser ist, also die noch die Beine einsetzen kann, liegt bei etwa 24,35 Meter. Nun kann es natürlich passieren, dass dort Weltrekord geworfen wird, meinetwegen 24,70 Meter, was aber nur die Silbermedaille ist, weil ich, die schwerer geschädigt ist, auch weiter geworfen hab. Noch ein Beispiel aus dem Kugelstoßen: Da habe ich Bronze gewonnen, und ich sage mal einfach, das ist fast Betrug, denn die Weite von 8,61 Meter, die von einer 56er gestoßen wurde, die ja besser dran ist, ist ja eigentlich keine Weite. Mein Weltrekord liegt bei 9,07 Meter. Das ist sehr, sehr schwierig und eigentlich fast nicht zu verstehen.
Und für den gemeinen Zuschauer besonders.

Die 55-jährige Buggenhagen beendet ihre Karriere.
Ja, aber es würde da Möglichkeiten geben. Man könnte beispielsweise sagen: Jemand, der schwerer geschädigt ist, kriegt zwei Meter Bonus, und dann hätte wirklich derjenige gewonnen, der plus Bonus am weitesten stößt. Und im Wintersport geht einfach die Uhr schneller oder langsamer.
Gibt es Pläne in diese Richtung?
Wir haben schon soviel eingereicht. Da wird sich nicht viel bewegen. Das ist sehr schwierig und in einigen Sachen auch ein bisschen unfair.
Die Paralympics 2008 konnten einen Zuschauerrekord verzeichnen. Welche Chancen sind mit der zunehmenden Aufmerksamkeit für die Paralympics und den Behindertensport verbunden?
Konkret für China kann ich mir nicht mehr vorstellen, dass die chinesischen Behindertensportler, überhaupt die Behinderten, versteckt werden können. Ich denke, dass die Leute, die das gesehen haben - im Stadion oder in der Übertragung - darüber nachdenken, wo die Behinderten plötzlich alle wieder geblieben sind. Ich glaube, dass die Behindertensportler nur gewonnen haben, nicht nur in Bezug auf die architektonischen Barrieren, die überall in Peking zu finden sind, sondern auch bezüglich der Aufmerksamkeit und der Identität: Dass man da ist, auch als Behinderter.
Sehen Sie auch Risiken, wenn der Behindertensport auf immer mehr Interesse stößt?

Bei den Olympischen Spielen legt Natalie du Toit vor ihrem Start zum 10-Kilometer-Marathon im Schwimmen ihre Prothese ab.
Das ist ja positiv und nichts Negatives. Was aber auffallend ist, ist die Professionalisierung im Behindertensport. Es ist nicht mehr so, dass man in zwei, drei oder vier Disziplinen starten kann, auch ich habe mich ja speziell auf das Diskuswerfen vorbereitet. Es ist alles viel professioneller. In einigen Ländern gibt es regelrecht Profis, die den Behindertensport als Lebensunterhalt betreiben. Da sind wir noch sehr weit weg.
Wenn man sich in diesem Zuge die Leistungsexplosion vor Augen hält, sehen Sie da die Gefahr, dass die Doping-Problematik auch im Behindertensport eine zunehmende Rolle spielen wird?
Nicht durch die Professionalisierung, aber ich kann mir vorstellen, sobald Geld eine Rolle spielt. Ich sage mal "Geld verdirbt die Welt", und ich denke, wenn man für eine Leistung bezahlt wird und nur für gute Leistungen auch Profit bekommt, versucht man natürlich, diese Leistungen mit allen Mitteln zu erreichen. Jetzt sind es "Unfälle" mit Haarwuchsmitteln oder Medikamenten, bei denen man nicht darüber nachdenkt. Aber professionelles Dopen ist im Behindertensport noch nicht so verbreitet, weil es noch keinen finanziellen Anreiz gibt.
Wie könnte man diese Entwicklung verhindern?
Wir sind schon dabei. Ich bin in der NADA und habe eine 24-Stunden-Abmeldepflicht. Ich muss immer aufschreiben, wo ich mich aufhalte, damit ich zu jeder Zeit für Kontrolluntersuchungen erreichbar bin. Ich bin natürlich für keine Freigabe, weil sich da ein Vorteil verschafft wird, was unfair ist. Ich hoffe, dass das Kontrollsystem, das weltweit ausgebaut wird, ausreichend ist, und vielleicht kommen auch die Sportler zu Verstand, dass man sich Leistung erarbeiten und nicht "erfuttern" muss.
Rückt der sportliche Gedanke zugunsten eines Leistungs- und Profitstrebens in den Hintergrund?
Die Gefahr besteht auf alle Fälle, weil es professioneller wird. Und der Wunsch, den wir haben, immer näher an die Olympischen Spiele zu kommen, beinhaltet das ja.

Bei der Abschlusszeremonie trägt Buggenhagen die deutsche Fahne.
Immer mehr Sportler mit Behinderungen haben für sich eine Teilnahme an den Olympischen Spielen eingefordert. Was halten Sie davon?
Ich habe grundsätzlich eine positive Einstellung, zum Beispiel bei der amputierten Schwimmerin (Natalie du Toit aus Südafrika), die ohne Unterschenkel bei den Olympischen Spielen mitgeschwommen ist. Ich habe aber ein gespaltenes Verhältnis, wenn man sich mit Hilfsmitteln wie Prothetik einen Vorteil verschafft und dann an den Olympischen Spielen teilnimmt, wie es beispielsweise der Südafrikaner (Oscar Pistorius) mit zwei Unterschenkel-Prothesen geplant hat. Integration finde ich wichtig, aber man kann es nicht gleichsetzen. Wenn wir das jetzt zulassen, dann müssten aber auch gleich Richtlinien gesetzt werden. Jemand mit Unterschenkel-Prothesen kann sich diese ja auch um 10 Zentimeter verlängern lassen und hätte dann Meilenstiefel an. Das sind Dinge, die erst überlegt werden müssen. Es darf kein Material-Doping geschehen, man darf sich durch Hilfsmittel keinen Vorteil gegenüber dem anderen verschaffen. Und darum finde ich das ohne Prothetik in Ordnung, wenn einer mit einem Arm genauso schnell läuft wie einer mit zwei Armen. Aber Hilfsmittel bleibt Hilfsmittel.
Wünschen Sie sich, dass die Olympischen Spiele und die Paralympics zusammengelegt werden?
Das wäre ein Traum, aber das passiert nie. Das erste, was uns aufgefallen ist, war: Wir kamen zum Aufwärmen ins Stadion und da wurden die Olympischen Ringe abgetapet. Wir waren ja schon mal viel, viel weiter. Wir hatten die fünf Tropfen als Symbol, das an das olympische Symbol angelehnt war. Aber es geht ja nur um Vermarktung. Durch die Olympischen Spiele wird soviel Geld verdient, da passen die Paralympics zurzeit noch nicht rein. Und ich glaube nicht, dass ich es noch erlebe, dass irgendwie eine Integration passiert. Demonstrationswettbewerbe jederzeit, aber Integration erlebe ich nicht mehr.
Sie beenden Ihre leistungssportliche Karriere. Welche Pläne haben Sie für die Zukunft?
Ich werde natürlich weiter Sport treiben. Wir haben in Bernau (bei Berlin) eine Basketballgruppe aufgebaut. Ich werde meinen Übungsleiter machen und werde dann auch Mobilitätstraining anbieten. Denn ich erlebe es ja in der Klinik, dass viele entlassen werden und eigentlich mit dem Rollstuhl nicht umgehen können, der Rollstuhl nicht richtig passt. Und da möchte ich helfen. Dann werden meine Bücher hoffentlich fertig geschrieben, die Drittauflage wird von überall verlangt. Und dann ist es so: Ich habe viele Bekannte, aber durch meinen Zeitmangel keine Freunde mehr. Es ist eine Teamleistung von meinem Mann, meinem Trainer, dem Olympiastützpunkt und auch meinem Arbeitgeber, die alle einen Teil dazu beigetragen haben, dass ich überhaupt diesen Erfolg erreiche. Aber die Freunde sind alle zu kurz gekommen und das schon jahrelang. Und ich möchte jetzt wieder Zeit für sie haben und gemeinsam mit ihnen etwas tun, damit man sich wieder ein bisschen besser kennenlernt.
Bleiben Sie bei Ihrem Engagement für den Behindertensport?
Ja. Da sind jetzt schon einige Anfragen gekommen, ob ich bei bestimmten Events als Kommentatorin dabei sein könnte. Wenn Hilfe gebraucht wird, kann man mich jeder Zeit ansprechen. Ich denke, dass ich im Behindertensport immer ein kleines bisschen zuständig bleibe. Ich werde auch darum kämpfen, dass ein reelles Punktesystem entwickelt wird. Und ich habe viele Behindertensportler, zu denen ich ein gutes Verhältnis habe und das wird auch nicht von heute auf morgen abgebrochen werden. Ich werde zu Wettkämpfen gehen, als Kampfrichter fungieren. Ich bleibe dem Behindertensport noch eine Weile erhalten.
Sie wurden von der französischen Regierung anlässlich der Ehrung europäischer Spitzensportler eingeladen. Inwieweit sind solche Anlässe förderlich, um die Belange des Behindertensports stärker in den Fokus der Aufmerksamkeit zu rücken?
Das sind Chancen. Man hat die Möglichkeit, auch mit Persönlichkeiten zusammenzukommen, die Macht haben. Denn wenn ich unseren Behindertensport betrachte, der ja eigentlich als Rehabilitationsmaßnahme aus dem Veteranensport entstanden ist, sind wir doch schon eine ganze Ecke weiter. Aber es sind ja viele, die diesen Leistungsgedanken gar nicht haben, und wir als Sportler müssen unsere Möglichkeiten nutzen, immer wieder zu sagen: Wir sind leistungsstark. Uns Behinderten wird relativ wenig zugetraut. Wir müssen beweisen, dass wir leisten können, was im Sport relativ gut geht anhand von Höhen, Weiten und Zeiten. Aber im normalen Leben ist das nicht machbar. Durch unser Auftreten können wir darauf hinweisen und sagen: Wir können, wenn die Vorraussetzungen da sind, fast die gleichen Leistungen bringen wie ein Nichtbehinderter. Ihr müsst bloß Vertrauen in uns haben und uns die Chance geben, es zu beweisen.
mit Marianne Buggenhagen sprach Nadin Härtwig
Quelle: ntv.de