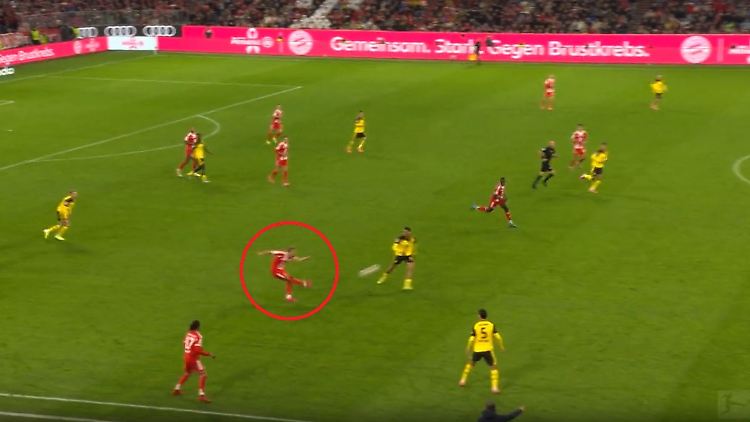Kein Grund für "Chip, Chip, Hurra!" Tortechnik lässt Fragen offen
06.07.2012, 13:49 Uhr
Phantomtore wie 2010 in Bloemfontein werden durch den Technikeinsatz nicht ausgeschlossen, aber seltener werden.
(Foto: picture alliance / dpa)
Das Ob ist geklärt, das Wann und Wie bleibt offen: Die überfällige Entscheidung der Fußball-Regelwächter pro Torlinientechnik allein macht noch keine Revolution. Während die Premier League eine zügige Einführung erwägt, drückt die Bundesliga aufs Bremspedal. Unklar ist unter anderem, wer die Kosten trägt - und welches System überhaupt genutzt wird.
Nie wieder "Wembley"? Die Revolution, die eigentlich gar keine ist, ist nach jahrelangen Diskussionen endlich beschlossene Sache. Die Frage nach Tor oder nicht soll künftig per Video oder Chip im Ball geklärt werden. Doch das war es dann auch schon. Denn das International Football Association Board (Ifab), also die oberste Regelinstanz des Fußballs, hat am Donnerstag nur entschieden, dass technische Hilfsmittel zur Überwachung der Torlinie gestattet sind. Nicht weniger, aber auch nicht mehr: Die Revolution darf stattfinden, sie wird von den Schiedsrichtern als große Entlastung gefeiert, aber sie wird noch eine Weile auf sich warten lassen. Vor der übernächsten Saison etwa wird sie in der Bundesliga nicht zum Einsatz kommen. Lediglich die englische Premier League erwägt den Einsatz schon zur neuen Spielzeit.
In Deutschland sollen nach dem ewigen Ringen um das Ob das Wann und Wie nicht übers Knie gebrochen werden. "Schnellschüsse in der Umsetzung darf es nicht geben", sagte DFB-Präsident Wolfgang Niersbach. Er begrüßt das Bekenntnis des Fußball-Weltverbandes Fifa grundsätzlich, ebenso Ligapräsident Reinhard Rauball. Doch ihre Äußerungen verraten auch Vorsicht. "Der Ligaverband wird sich alsbald im Hinblick auf die Saison 2013/14 mit dem Einsatz befassen", sagte Rauball.
In der Tat sind viele Fragen ungeklärt: welches System, bis zu welcher Liga, wer trägt die Kosten von 250.000 Euro pro Stadion? Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat darauf zunächst keine Antworten. Rauball verwies auf die "zuständigen Gremien". Zumindest in der Kostenfrage macht sich Martin Kind, Präsident von Hannover 96, keine Illusionen: "Die Anschaffungskosten werden letztlich die Vereine übernehmen müssen. Alles andere halte ich für unrealistisch."
"Hawk-Eye" oder "GoalRef"?
Zunächst wird weiter getestet. Bei der Klub-WM im Dezember in Tokio, danach beim "Confed Cup" in Brasilien 2013. Bei der WM 2014 soll die Torlinien-Technik dann tatsächlich hochoffiziell zum Einsatz kommen. Doch welche? "Hawk-Eye" oder "GoalRef"? Das Ifab ließ offen, welches der schon erprobten Systeme zum Einsatz kommen sollte. Das "Hawk-Eye", vor allem durch den Einsatz beim Tennis bestens bekannt, überwacht die Torlinie mit Kameras. "GoalRef", entwickelt in Erlangen beim Fraunhofer-Institut, arbeitet mit einem Magnetfeld am Tor und dem "Chip im Ball". Der Schiedsrichter erhält jeweils ein Signal auf die Armbanduhr.
Beide Systeme haben aber auch Nachteile. Das "Hawk-Eye" etwa wird "blind", sollte ein Spieler auf dem Ball liegen, also die Sicht der Kameras verstellt sein. Die englische Firma hat immerhin einen kleinen Wettbewerbsvorteil, sie ist von Sony aufgekauft worden, der Konzern ist ein großer Sponsor der Fifa. "GoalRef" würde keinen "toten Winkel" wie das "Falkenauge" haben, doch stellen sich dort andere Fragen, etwa jene: Überlebt es der Chip im Ball, wenn er mit voller Wucht gegen den Pfosten fliegt? Verfügen die speziell präparierten Bälle über die gleichen Eigenschaften wie ihre Brüder ohne Sendeeinheit?
"Schon noch viele Fragen offen"
Das Fraunhofer-Institut hat seine Entwicklung in der dänischen Liga mit dem Ball eines dänischen Herstellers vorangetrieben (Derbystar). Dessen Geschäftsführer Peter Knap erklärt: "Die Herausforderung war es, einen Ball zu entwickeln, der sogar einem Schuss von Ronaldo standhält und gleichzeitig mit dem intelligenten Tor kommuniziert." Ingmar Bretz, zuständiger Projektleiter beim Fraunhofer-Institut bestätigt: "Es ist alles getestet worden, es kann nichts kaputt gehen." Das "GoalRef"-System kann auch in die Bällen anderer Hersteller integriert werden. Und es kommt wohl insgesamt billiger als "Hawk-Eye".
"Es sind schon noch viele Fragen offen", kommentierte Deutschlands "Schiedsrichter des Jahres", Knut Knircher, die Entscheidung. Es sei aber schön, dass das Regelkomitee Ifab des Weltverbandes Fifa "das Tor für die Technik aufgemacht hat". Ihm sei egal, welche Technik eingesetzt werde", meinte der Fifa-Referee. Wichtig sei, dass sie "100-prozentig funktioniert und in der Praxis eine große Prozesssicherheit hat". Jürgen Klopp, Coach von Borussia Dortmund, sagte lapidar: "Wenn ein Spieler ein Tor schießt, finde ich es ganz praktisch, wenn es dann auch gilt."
Technik-Dammbruch ausgeschlossen
Eines hat das Ifab sehr deutlich gemacht: Der Einsatz von Technik wird sich auf die Torlinie beschränken. Unberührt bleiben also Entscheidungen, die weitaus häufiger getroffen werden, etwa bei Abseitssituationen oder beim Foulspiel. Eine entsprechende Entscheidung obliegt in diesen Fällen weiter dem Schiedsrichter - wie kurioserweise auch bei der Frage: Tor oder nicht? Das Bemerkenswerte: Die Fifa gestattet den Einsatz der Technik, schreibt den Unparteiischen aber nicht zwingend vor, sich danach zu richten. Der Schiedsrichter kann sich also gegen das Urteil der Technik entscheiden.
Es ist der typische Funktionärs-Minimalkonsens, der durch einen weiteren verwirrenden Entscheid perfekt gemacht wird: Die Regelhüter des Ifab gestatten weiter den Einsatz von Torrichtern. Die zusätzlichen Schiedsrichterassistenten werden von Uefa-Präsident Michel Platini bevorzugt - auch wenn sie bei der EM in Polen und der Ukraine durch Fehlentscheidungen auffällig wurden, klar erkennbar vor allem beim Treffer der Ukraine gegen England, der nicht gegeben wurde.
Das bedeutet: Die Fifa mag bei ihren Turnieren die Technik einsetzen, Platini und die Europäische Fußball-Union (Uefa) können bei ihren Wettbewerben auf die Augen der Torrichter setzen. Auf diese Weise kann sich der Fußball-Weltverband als reformwillig präsentieren, ohne die Reformverweigerer zu verprellen.
Nie wieder "Wembley"? Wohl kaum.
Quelle: ntv.de, sid/dpa