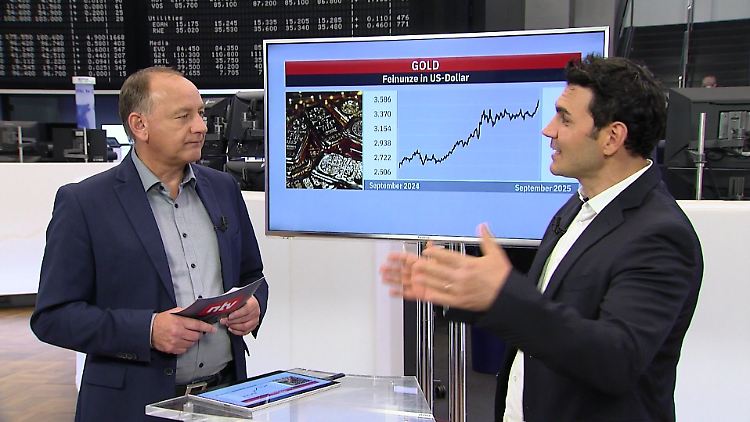Sonderwirtschaftszonen als Ausweg Berlin feilt am Wachstumsplan
25.05.2012, 10:40 Uhr
Die Devise lautet: Wachstum.
(Foto: REUTERS)
Sonderwirtschaftszonen, Treuhandanstalten sowie Arbeitsmarktreformen nach deutschem Vorbild in Euro-Krisenländern: Das sieht angeblich ein Plan der Bundesregierung vor, um für Wachstum in der Eurozone zu sorgen. Doch Berlin hält sich bedeckt.
Schaut man aus der Ferne nach Europa, herrscht auf dem Kontinent mitten in der Schuldenkrise derzeit große Einigkeit. Dabei hat sich der Fokus der öffentlichen Debatten merklich verschoben. Ging es 2011 vor allem darum, die Schuldenstaaten auf immer härtere Vorgaben für die Haushaltsdisziplin festzulegen, fordern derzeit von Rom bis Helsinki, in Paris und in Berlin, von der FDP bis zum sozialistischen französischen Präsidentschaftskandidaten Francois Hollande alle nur eines - Wachstum. Zwar nutzen die Politiker dasselbe neue Zauberwort, aber sie meinen damit völlig unterschiedliche Dinge.
Die einen setzen angesichts von Arbeitslosigkeit und Konjunkturschwäche auf Stimuli, also schuldenfinanzierte Wachstumsimpulse. Die anderen lehnen solche Konjunkturprogramme ab und setzen stattdessen auf Strukturreformen. Zu den letzteren gehört die Bundesregierung, die offenbar eine Strategie für mehr Wachstum in Europa entwickelt hat.
Es gebe einen entsprechenden Sechs-Punkte-Plan, berichtete der "Spiegel". Dieser sehe unter anderem vor, in den krisengeschüttelten Randstaaten des Euroraums Sonderwirtschaftszonen einzurichten. So könnten ausländische Investoren mit steuerlichen Vergünstigungen und weniger strengen Regulierungen angelockt werden. Die Krisenländer sollen zudem Treuhandanstalten nach deutschem Muster oder Privatisierungsfonds einrichten, um ihre zahlreichen Staatsbetriebe zu verkaufen, hieß es. Zudem sollten EU-Länder ihren Arbeitsmarkt nach deutschem Vorbild reformieren. Die Umsetzung sei aus Wettbewerbsgründen aber fraglich.
Konkrete Vorschläge angekündigt
Regierungssprecher Steffen Seibert wollte einen solchen Plan weder bestätigen noch dementieren. Er betonte aber, die Regierung arbeite an konkreten Vorschlägen für Wachstums- und Beschäftigungsimpulse in kriselnden Euro-Ländern. Diese würden der Opposition in den Verhandlungen über die Umsetzung des europäischen Fiskalpaktes sowie den europäischen Partnern vorgelegt. Der EU-Gipfel Ende Juni solle dann konkrete Beschlüsse fassen.
Der Sprecher des Finanzministeriums, Martin Kotthaus, verwies grundsätzlich darauf, dass Steuerermäßigungen in der EU im Rahmen von Sonderwirtschaftszonen aus wettbewerbsrechtlichen Gründen schwierig werden dürften. Ein 16-Punkte-Plan von Wirtschaftsminister Philipp Rösler für mehr Wachstum enthielt keinen Vorschlag für Sonderwirtschaftszonen. Im Oktober 2011 hatte der FDP-Politiker diese aber bei einem Besuch in Athen ins Gespräch gebracht.
Hollande gegen Merkel
Die Grundüberzeugung hinter Berlins Standpunkt ist, dass Wachstum letztlich aus mehr Wettbewerbsfähigkeit entstehe. Tatsächlich hatte die EU schon im vergangenen Jahr auf deutschen Druck den "Euro-Plus-Pakt" geschlossen, der ursprünglich "Pakt für Wettbewerbsfähigkeit" heißen sollte. Dabei müssen die Euro-Staaten der EU-Kommission jährliche Berichte abgeben, wie sie Reformen in zentralen Bereichen wie Arbeitsmarkt und Sozialsystemen Reformen vorantreiben. Frankreich sorgte aber damals dafür, dass das Wort "Wettbewerbsfähigkeit" aus dem Titel gestrichen wurde.
Der neue französische Präsident Francois Hollande nutzt "Wachstum" als Wort dafür, erneut staatliche Ausgabenprogramme und neue Finanzierungsformen zu fordern. Während Merkel eine Wachstumsstrategie ausdrücklich als komplementär zu einem strikteren Sparen sieht, haben auch Sozialdemokaten in den Niederlanden und Luxemburg sowie die konservative spanische Regierung deutlich gemacht, dass sie Wachstum auch durch weniger harte Sparziele erreichen wollen. Ausdrücklich warnte etwa Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn, dass sich Europa nicht kaputt sparen und das soziale Gefälle in den EU-Staaten nicht zu groß werden dürfe.
Projektbonds in der Pipeline
Befürworter staatlicher Konjunkturprogramme bringen häufig sogenannte Eurobonds in Spiel, also gemeinsame europäische Staatsanleihen. Die Bundesregierung lehnt diese jedoch strikt ab. Sie hält nichts von der Idee, dass jedes Mitgliedsland selbst über Steuern und Ausgaben bestimmt, die Konsequenzen für unsolide Haushaltspolitik aber von der gesamten Währungsunion getragen werden müssten.
Deshalb werden in der EU Planungen für sogenannte Projektbonds vorangetrieben. Das sind gemeinschaftliche Finanzierungen konkreter Projekte, etwa im Infrastrukturbereich. In einer Pilotphase bis Ende 2013 will die EU 230 Mio. Euro aus dem eigenen Budget stellen. Dieser Betrag soll mit Hilfe privater Investoren auf 4,6 Mrd. Euro anwachsen. Für Wachstum in Krisenländern wird das allerdings nicht sorgen, dafür ist das Volumen viel zu klein.
Quelle: ntv.de, jga/rts/DJ