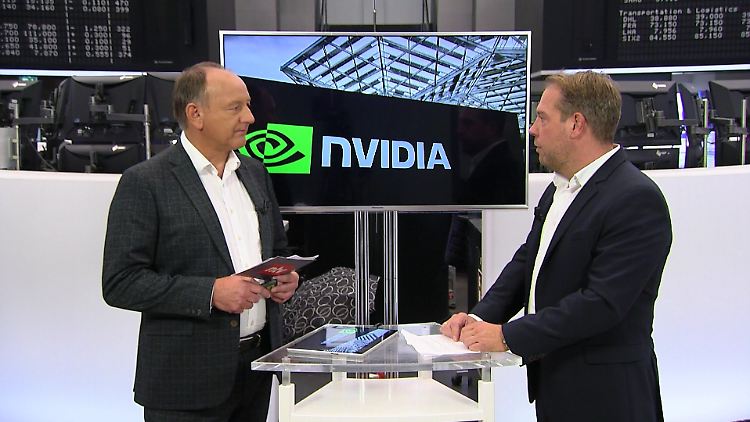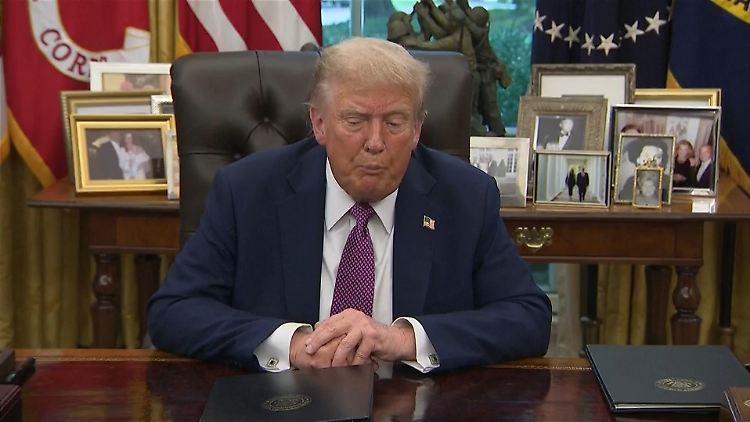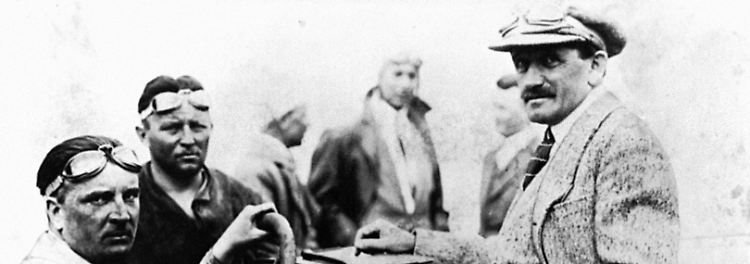Der Euro-Gipfel und die Baustellen Keine "Mutter" aller Lösungen
25.10.2011, 21:13 Uhr
Zu viele Probleme: da bleiben viele Lösungsansätze unscharf.
(Foto: picture alliance / dpa)
Griechenland-Hilfe, EFSF-Hebel, Banken-Rekapitalisierung: Der Euro-Gipfel hat einiges vor sich - und wird Experten zufolge nicht mit einer umfassenden Antwort auf die Probleme aufwarten können. Aber auch Kleinvieh macht Mist. Bleibt nur die Frage, ob die Märkte das auch so sehen.
Nach mehr als einem Dutzend Gipfeltreffen zur Euro-Krise drohen die Staats- und Regierungschefs der Euro-Staaten die umfassende Antwort auf die Schuldenkrise erneut schuldig zu bleiben. Wie Vertreter von Euro-Ländern der Nachrichtenagentur Reuters sagten, wird der Gipfel voraussichtlich kaum konkrete Zahlen zu den Baustellen der Krise nennen - Griechenland-Hilfe, Hebelwirkung beim Euro-Rettungsfonds EFSF und Kapitalstärkung der Banken.
Mit einer beeindruckenden riesigen Summe, um das Überleben der Währungsunion zu sichern, ist somit kaum zu rechnen. Es sei denn, die ab Dienstag in Brüssel tagenden Experten aus den Finanzministerien der Euro-Länder finden über Nacht den Ausweg aus dem Chaos.
Alles eine Frage der "Zahlen"
Nach derzeitigem Stand werden die Verhandlungen mit den Banken über einen höheren Forderungsverzicht gegenüber Griechenland aber voraussichtlich nicht bis zum Euro-Sondergipfel abgeschlossen sein. "Wir werden versuchen, eine Zahl zum Schuldenschnitt Griechenlands zu bekommen, aber ob wir damit Erfolg haben werden, ist die Frage", bezweifelte eine mit den Vorbereitungen vertraute Person.
Zum Umfang der öffentlichen Unterstützung für Griechenland im Rahmen des zweiten Rettungspaketes solle jedoch eine Zahl genannt werden. Wenn zugleich eine Größenordnung genannt werde, wie stark der Schuldenstand Griechenlands bis 2020 sinken solle, ergebe sich daraus der erwartete Forderungsverzicht.
Schwierige Verhandlungen
Beim Gipfel soll ein zweites Rettungspaket für Griechenland als ein Element der umfassenden Strategie der Euro-Länder gegen die Schuldenkrise geschnürt werden. Da die Finanznot des Landes viel größer ist, als im Juli angenommen, sind die damals vereinbarten Beiträge von öffentlichen und privaten Gläubigern Makulatur. Im Juli sollten die Euro-Länder und der Internationale Währungsfonds (IWF) zusammen noch 109 Mrd. Euro bis 2014 aufbringen, die privaten Gläubiger 50 Mrd. Euro, was nach offiziellen Angaben einem Forderungsverzicht von 21 Prozent entsprach. Nun sollen die Banken und Versicherungen jedoch auf mehr als 50 Prozent ihrer Forderungen aus griechischen Staatsanleihen verzichten.
Die Verhandlungen sind EU-Diplomaten zufolge schwierig. Davon abgesehen müsse ohnehin Griechenland den Verzicht mit den Gläubigern selbst aushandeln. Es sei unwahrscheinlich, dass dies bis Mittwochabend gelinge, sagte ein mit der Sache Vertrauter. Der Beitrag des öffentlichen Sektors werde voraussichtlich nur wenig höher ausfallen als die bisher angepeilte Summe von 109 Mrd. Euro.
In deutschen Regierungskreisen hatte es geheißen, als Marke für einen tragfähigen Schuldenstand Griechenlands wären zunächst 120 Prozent der Wirtschaftsleistung bis 2020 anzupeilen. Die Troika von EU, Europäischer Zentralbank und IWF hatte in ihrem Bericht zu Griechenland vorgerechnet, dass 120 Prozent zu erreichen sind bei öffentlichen Hilfen von 114 Mrd. Euro und 50 Prozent Forderungsverzicht der Privatgläubiger.
Berlin gegen Paris
Eine plakativ große Zahl zur besseren Krisenabwehr, die auf Basis des EFSF-Kreditrahmens von 440 Mrd. Euro mit einem Hebel zu erreichen wäre, wird es den Insidern zufolge auch nicht geben. Das ist demnach rein praktisch gar nicht berechenbar, weil die Modelle zur Hebelung kompliziert sind und ihr Effekt von vielen unbekannten Größen abhängig ist.
Auf dem Tisch liegen zwei Modelle - eine teilweise Verlustabsicherung durch den EFSF für die privaten Aufkäufer von Staatsanleihen oder die weitaus kompliziertere Lösung, eine oder mehrere Zweckgesellschaften zu bilden, die Kapital von privaten Investoren einsammeln, um daraus mithilfe des EFSF noch mehr Geld am Kapitalmarkt zu pumpen.
IWF erwägt Beteiligung
Offenbar erwägt auch der IWF eine Beteiligung an dem Modell Zweckgesellschaft SPIV. Dies habe der Internationale Währungsfonds angedeutet, aber noch keine Position bezogen, sagte eine mit den Überlegungen vertraute Person. Ein anderer Euro-Zonen-Vertreter sagte, "sie haben noch nicht zugestimmt, aber sie haben es auch nicht ausgeschlossen." Einem weiteren Insider zufolge ist es auch möglich, dass der IWF ein Sonderkonto für den EFSF einrichtet. Auf dieses könnten IWF-Mitglieder oder möglicherweise Staatsfonds Geld einzahlen, um der Euro-Zone zu helfen.
"Die Chefs werden sich über die Optionen morgen verständigen", sagte ein Insider, "aber nicht über alle Details." Ein anderer sagte, einige Länder wollten eine Größenordnung nennen. "Man könnte die Parameter so präsentieren, dass der Markt eine Vorstellung über das mögliche Ergebnis bekommt", ergänzte er. Und schließlich könnte der Kapitalbedarf der Banken - am Samstag von Diplomaten bereits auf bis zu 110 Mrd. Euro beziffert - am Ende zur Unbekannten werden.
Die Verwirrung vor dem Gipfel steigerte noch das Hin und Her über eine Sitzung der Finanzminister der 27 EU-Staaten. Angesichts der notwendigen stärkeren Integration der Euro-Zone befürchten die Nicht-Euro-Länder - allen voran Großbritannien und Schweden - dass sich die Euro-Zone verselbständigt und EU-weit relevante Entscheidungen über ihre Köpfe hinweggetroffen werden. So kam es, dass der EU-Gipfel am Sonntag einen Finanzministerrat für Mittwochvormittag ansetzte, obwohl es vor dem Euro-Gipfel noch gar keine neue Entscheidungsgrundlage gab.
Der Ecofin am Mittwoch wurde abgesagt, was Zweifel aufkommen ließ, ob der Euro-Gipfel überhaupt stattfindet. Nach jetzigem Stand steht dies nicht infrage.
Quelle: ntv.de, rts