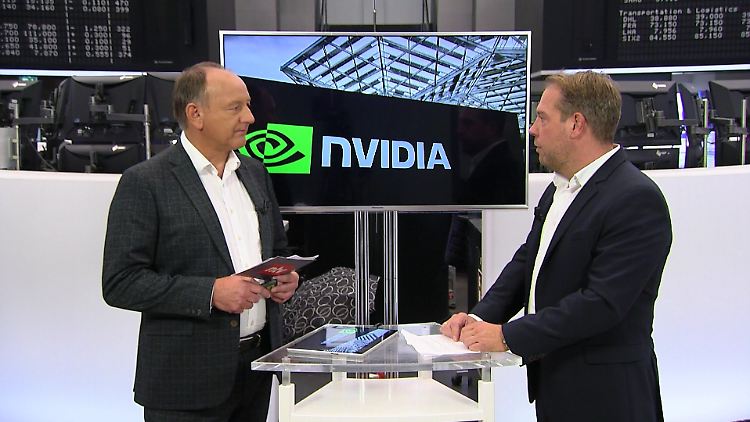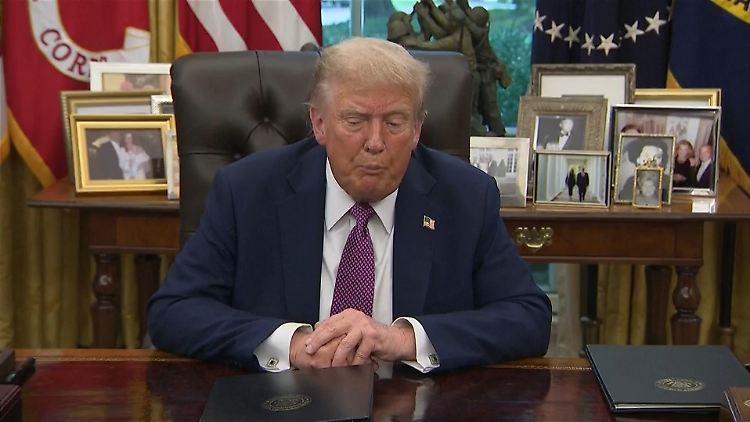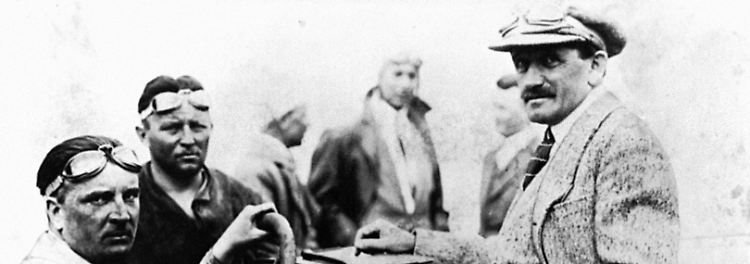Transfergesellschaft steht nicht Länder bei Schlecker uneins
22.03.2012, 17:55 Uhr
Die Regale leeren sich, eine Lösung ist nicht in Sicht.
(Foto: dpa)
Die Finanzierung der Auffanggesellschaften für entlassene Schlecker-Mitarbeiter ist immer noch nicht in trockenen Tüchern. Die Bundesländer können sich nicht auf die Aufteilung der Bürgschaften für einen Kredit der staatlichen Förderbank KfW einigen. Nun will Baden-Württemberg mit guten Beispiel vorangehen.
Die Bundesländer haben sich noch nicht auf ein Finanzierungskonzept für eine Auffanggesellschaft einigen können, die mehr als 10.0000 Beschäftigte der insolventen Drogeriekette Schlecker vor dem Absturz in die Arbeitslosigkeit bewahren soll.

Baden-Württemberg prüft nun erstmal einen ersten Alleingang, sagt Finanzminister Nils Schmid.
(Foto: dapd)
"Wir haben noch keine endgültige Einigung", sagte der baden-württembergische Finanz- und Wirtschaftsminister Nils Schmid nach einem mehrstündigen Treffen von Ländervertretern in Berlin. Es bestehe aber grundsätzlich Einvernehmen, dass sich alle Länder an dem Auffangprozess beteiligen wollen.
Angesichts der Eilbedürftigkeit einer Entscheidung wolle Baden-Württemberg nun prüfen, bei der Verbürgung eines Kredits von 70 Millionen Euro, mit dem die Auffanggesellschaft möglich gemacht werden soll, in Vorleistung zu treten. Der Insolvenzverwalter brauche jedenfalls bis Ende der Woche eine konkrete Finanzierungszusage, sagte Schmid.
Vereinbart wurde laut Schmid, dass die Länder entsprechend der Zahl der jeweils verbleibenden Arbeitsplätze dafür bürgen. Baden-Württemberg würde damit notfalls für etwa ein Zehntel der Summe geradestehen, sagte Schmid. Auch auf Nordrhein-Westfalen und Bayern kämen hohe Beiträge zu.
Bis zum Sonntag oder Montag soll den Ländern eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit einem Gutachten Klarheit über die Liquidität der Gesellschaft, die Rückführbarkeit des Darlehens und Sicherheit geben. "Meine Skepsis ist nicht wirklich beseitigt", sagte der sächsische Wirtschaftsstaatssekretär Hartmut Fiedler (FDP). Die rheinland-pfälzische Arbeitsministerin Manu Dreyer (SPD) sagte zum Ausgang des fünfstündigen Treffens: "Persönlich bin ich ein bisschen enttäuscht."
Schmid bestätigte, dass der Insolvenzverwalter zur Finanzierung der Transfergesellschaft zusätzlich 15 Mio. Euro aus der Insolvenzmasse zusteuern wolle. Insgesamt seien elf Gesellschaften geplant.
Zeit drängt
Bei der insolventen Drogeriekette Schlecker sollen rund 2200 Filialen geschlossen werden. Betroffen sind davon womöglich mehr als 11.000 Beschäftigte. Sie sollen in mehreren Transfergesellschaften zur Weiterbildung und Hilfe bei Bewerbungen unterkommen. Die Zeit drängt: Die Einkommen der Schlecker-Beschäftigten sind nur bis Ende März durch das Insolvenzgeld gesichert. Kommen die Transfergesellschaften nicht zustande, droht ihnen ab April Arbeitslosigkeit.
Die Rettungsidee stößt jedoch nicht überall auf Gegenliebe. So hält der Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW), Michael Hüther, ein Eingreifen des Staates bei Schlecker für falsch. Angesichts der Dynamik auf dem Arbeitsmarkt sei es durch nichts zu begründen, eine Auffanggesellschaft für die betroffenen Schlecker-Beschäftigten zu gründen, sagte er dem "Handelsblattt". "Unser Sozialsystem bietet über das Arbeitslosengeld I eine hinreichende Abfederung", betonte er. "Und was sollen kleine Einzelhändler in starkem Wettbewerb stehend davon halten, wenn Große so abgefedert werden?"
Es sei immer derselbe "politische Reflex", sagte Hüther weiter. "Kaum kommt ein großes, bundesweit agierendes Unternehmen in eine schwierige Lage, dann wird mit großer Geste Hilfe gefordert und meistens auch gewährt." Unternehmerisches Versagen wie bei Schlecker gehöre zur marktwirtschaftlichen Ordnung.
Transfer- oder Qualifizierungsgesellschaften sind ein gängiges Instrument, um die Folgen von Jobabbau und Unternehmensinsolvenzen für die Arbeitnehmer abzumildern. Sie spielten bei praktisch allen größeren Entlassungswellen der vergangenen Jahre eine Rolle, etwa beim früheren Staatsunternehmen Deutsche Telekom, bei Opel, Karstadt, Quelle oder zuletzt beim Energieriesen Eon. Sie sollen die entlassenen Mitarbeiter schulen, weiterbilden und beraten - immer mit dem Ziel, ihnen den Wechsel in einen neuen Arbeitsplatz zu erleichtern. Die Gesellschaften organisieren Bewerbertrainings und helfen bei der Jobsuche.
Quelle: ntv.de, sla/rts/dpa