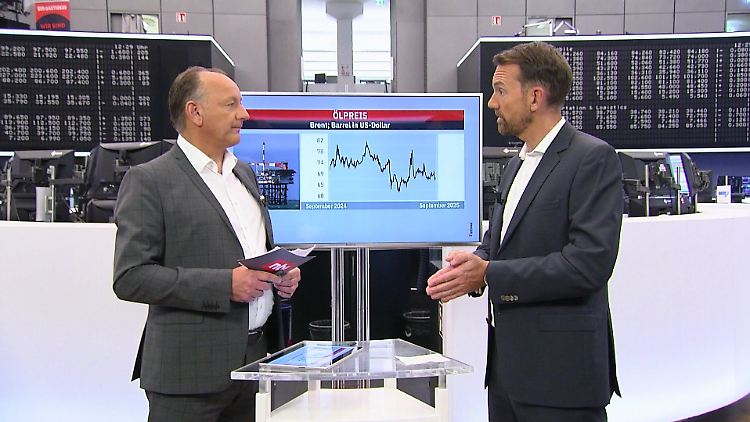Vodafone-Deal mit Verizon macht's möglich US-Banken zementieren Beratervormacht
02.09.2013, 20:35 Uhr
Spieglein, Spieglein, an der Wand ... Goldman Sachs ist der M&A-König weltweit.
(Foto: REUTERS)
Bei Übernahmen und Fusionen spielen die US-Großbanken in einer eigenen Liga: Aktuellen Daten zufolge liegen vier US-Finanzinstitute im M&A-Ranking vorn. Nicht zuletzt nacht das der Mega-Deal in der Telekombranche möglich. Eine Bank sticht dabei sogar noch heraus.
Die 130 Milliarden Dollar schwere Mobilfunk-Transaktion zwischen Vodafone und Verizon hat die führende Rolle von US-Großbanken als Berater bei großen Deals gestärkt. Aktuellsten Daten von Thomson Reuters zufolge baute der Vodafone-Berater Goldman Sachs seinen Vorsprung als Top-Adresse bei Übernahmen und Fusionen (Mergers & Aquisitions; M&A) in diesem Jahr aus und kommt mittlerweile auf 241 solcher Deals. Deren Gesamtvolumen liegt demnach bei 476 Milliarden Dollar.
Auf den Plätzen zwei, drei und vier stehen weitere US-Großbanken: Bank of America, JP Morgan und Morgan Stanley. Die britische Barclays, die mit Verizon zusammengearbeitet hat, steigt durch ihre Teilnahme an dem Geschäft auf Rang fünf auf. Zuvor lag sie auf der achten Position. Die Schweizer UBS springt auf sechs von zehn.
Telekom-Branche sticht hervor
Insgesamt ist der M&A-Markt 2013 bislang schwächer als im Vorjahr. Das gilt aber nicht für den Sektor Telekommunikation. Denn dort gab es auch ohne das Geschäft Vodafone/Verizon bereits ein Plus von 28 Prozent auf 94,3 Milliarden Dollar. Inklusive des Deals beträgt der Zuwachs gar 202 Prozent auf 224,3 Milliarden. Das ist bislang bereits der höchste Stand seit 2006.
Beratungsmandate für das Vorhaben, bei dem Vodafone sein US-Geschäft an seinen bisherigen Partner Verizon für 130 Milliarden Dollar verkauft, treiben auch die Summe der Gebühren in die Höhe, die die Banken einstreichen. Schätzungen zufolge fließen bei einem solchen Übernahmevolumen insgesamt 200 Millionen bis 250 Millionen Dollar in deren Kassen.
Auch hier führt Goldman die Rangfolge an. Reuters-Daten zufolge kommt das Institut schon ohne den jüngsten Deal auf etwa 983 Millionen Dollar. Insgesamt sind die Gebühreneinnahmen im bisherigen Jahresverlauf weltweit aber so gering wie seit 2009 nicht mehr.
Quelle: ntv.de, rts